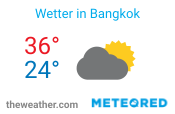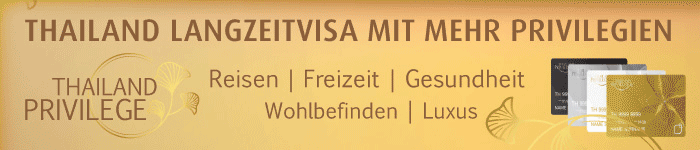„Ist es auch Tollheit, so hat es doch Methode.”* Ein Farang, der dieses Zitat im Hinblick auf den Alltag in Thailand und die Verlautbarungen der Regierung verinnerlicht, ist ein glücklicher Farang. Vielleicht zuckt er hin und wieder noch mit den Schultern, aber das ist auch schon das Äußerste der Gefühle, das er sich noch leistet. Er ist jetzt ein Eingeweihter, da tun sich Überraschungen sogar hierzulande schwer.
Hat er dies erst einmal geschafft, droht ein anderer Fallstrick: Er bildet sich etwas darauf ein und fühlt sich den Expats gegenüber, die sich später hier niedergelassen haben („Ech be zerscht do gsy”) und noch nicht zu dieser Erkenntnis gelangt sind, überlegen. Er kichert in sich hinein, wenn ihm der Knatsch mit der Immi, die irren Covid-Regeln und Details über das gespenstische Verkehrschaos hinterbracht werden.
Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin auch tief gefallen und hätte mich beinahe unsterblich blamiert. Doch wo Gefahr droht, ist auch Rettung nahe, mich rettete ein Käse, ein Gruyère notabene. Absurd? Lies weiter:
Aus der Zeit gefallen
Bei unserer Ankunft vor gut fünf Jahren gab es im Resort nur einen einzigen Schweizer, der hier die Festung hielt: Ein dünner, kleiner Mann mit einem zotteligem Bart, der in wilden Stoppeln unter seinem großen Strohhut hervorquoll. Er war stets weißgekleidet und in die überweiten Hosen hätte bequem noch ein anderer seiner Art gepasst. Er flanierte tagtäglich zur selben Zeit mit seinem Hund, einem weißen Spitz, zwischen den Gärten bis zum Rand des Resorts und wieder zurück. Er schien ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein, Wilhelm Busch hätte seine Freude an ihm gehabt.
Es hat dann auch eine Weile gedauert, bis wir ins Gespräch gekommen sind. Sein Gesicht verschwand ja buchstäblich unter der gewaltigen Krempe und der Rest warf einen großen Schatten auf den Asphalt, welchem das perlweiße Fell des Hundes vorantrottete.
Es ist müßig zu sagen, dass dieses humane Gesamtkunstwerk hier für einiges Aufsehen sorgte, aber eigentlich nur bei den anderen Farangs. Die Thais dachten vermutlich, dass alle Schweizer so unterwegs sind und dass ich hier der Eigenbrötler sei. Ich hielt dem sozialen Druck aber stand und passte mich nicht an. Ich ließ mir weiterhin keinen zotteligen Bart wachsen, trug keinen Sombrero und statt mit einem Spitz herumzuflanieren, fütterte ich bloß hin und wieder einen Spatz.
Irgendwann kreuzten sich unsere Wege, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es kann sein, dass er dem Hund etwas zurief, wie:
„Chomm jetzt, ech wott hei,” oder so.
Damit war alles klar.
Wir wechselten bei jedem Treffen ein paar Worte und ich teilte mit ihm den Gruyère, den Freunde und Bekannte aus der Schweiz mitbrachten. Es war schwierig, das Mitbringsel vor ihm zu verstecken, denn der Geruch schwebte penetrant über der Anlage und der Hund bellte grundsätzlich nur dann, wenn eine neue Lieferung eingetroffen war. Ich konnte dem Mann nachfühlen, wie das Wasser in seinem Mund zusammenlief. Aber erst wenn er vor unserem Garten auffällig lange Gassi ging, ist bei mir jeweils der Groschen gefallen und ich beeilte mich, ihm seinen Anteil zu geben.
Hiobsbotschaft
Aber gestern wartete er mit einer Hiobsbotschaft auf.
„Wir sind jetzt nicht mehr allein..., es sind drei neue Expats da, alles Schweizer..!”
Ich schaute ihn entgeistert an.
„...ja..., zwei in meiner Nachbarschaft, einer weiter vorne beim Eingang...”
Mir kam eine Szene aus dem Film „Der längsteTag” in den Sinn. Ein Soldat der Wehrmacht schaut mit dem Feldstecher aus seinem Bunker, sieht die Kriegsschiffe der Allierten vor der Küste der Normandie und schreit:
„Mein Gott, die Invasion...!”
Der Schreck fuhr mir tief in die Glieder.Vorbei die Zeiten also, wo wir hier als eine exklusive, geschützte Art Privilegien genossen hatten. Jedermann war klar, dass wir reiche Schweizer waren, die mit perfektem Understatement versuchten, allen Sand in die Augen zu streuen, um den milliardenschweren Hintergrund zu vertuschen. Sie vermuteten, dass wir uns damit vor potentiellen Halunken schützten wollten, spielten mit und taten, als hätten sie uns nicht durchschaut. Das sicherte uns Respekt und Wohlwollen zu, denn wer will sich schon mit Tycoons anlegen, die unerkannt bleiben wollen?
Kein Kredit bei Tante Ning
Mir war klar: Wenn hier echte Qualitätsschweizer auftauchen, werden wir als Schwindler auffliegen, die in Thailand ihre armseligen Renten verbraten. Wir könnten nicht einmal mehr bei „Tante Ning“ anschreiben lassen und hätten Rayonverbot um ihren Laden.
Am Abend hatte ich mich soweit erholt, dass ich wieder „strategisch” denken konnte (das habe ich von General Guisan) und weihte meinen Nachbarn ein:
„Also..., dir dürfte klar sein, dass wir es mit einer Massenimmigration zu tun haben..., ok?“ Der Spitz wedelte zustimmend mit dem Schwanz.
„Wir müssen uns gegen die Verschweizerung des Resorts mit aller Kraft zur Wehr setzen. Hier ist mein Abwehrdispositiv**:
Wir gründen einen Ortsverein nach dem Modell einer bekannten Partei in der Heimat.
„Du bist der Präsident, ich der Kassierer (mein Nachbar schluckte hörbar leer, die Rollenverteilung kam ihm irgendwie verdächtig vor). Dann hissen wir am Eingang eine Schweizer Flagge und schärfen den Thai-Guards ein, keine Schweizer mehr hereinzulassen, das Boot sei voll, das Kontingent ausgeschöpft. Was hälst du davon?”
Er druckste ein bisschen herum, schob den Strohhut in den Nacken, kratzte sich am Kopf und sagte: „Alles ok... Aber was machen wir mit den drei Neuen, die schon da sind...?”
„Die müssen wir wohl oder übel nehmen... Wir schicken sie zur Rush hour in die Stadt und wenn sie lebend zurückkommen, dürfen sie als vorläufig Aufgenommene bleiben...”
Der Plan ging leider gründlich schief. Mein Nachbar hat die Seiten gewechselt. Die Neuen haben ihn bestochen. Mit Gruyère, womit denn sonst?
PS: Der Spitz wedelt auch nicht mehr, wenn er mich sieht und zieht sein Herrchen auf die andere Straßenseite. Bei ihm hat‘s wohl ein Cervelat gebracht.
* Shakespeare, Hamlet
** Aus dem Schweizer Soldatenbuch von 1958
 Über den Autor
Über den Autor
Khun Resjek lebt mit seiner thailändischen Frau und Tochter in Hua Hin. Seine Kolumne „Thailand Mon Amour“ illustriert auf humorvolle Weise den Alltag im „Land des Lächelns“ aus der Sicht eines Farang und weist mit Augenzwinkern auf das Spannungsfeld der kulturellen Unterschiede und Ansichten hin, die sich im Familienalltag ergeben. Ein Clash der Kulturen der heiteren Art, witzig und prägnant auf den Punkt gebracht.