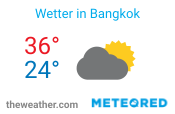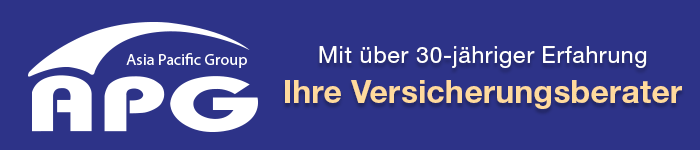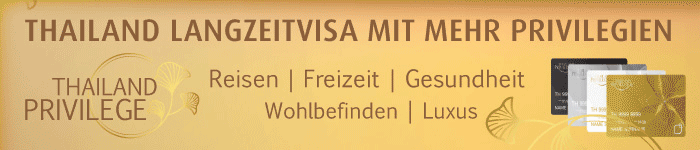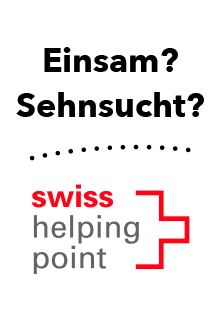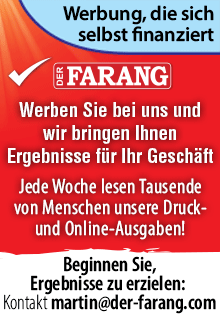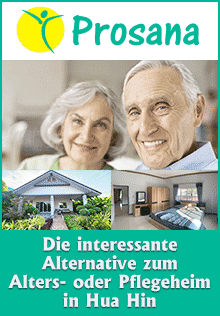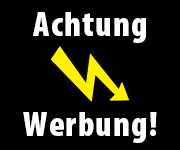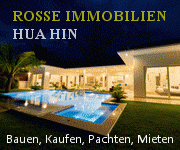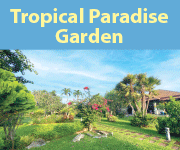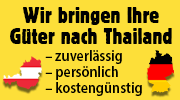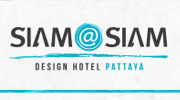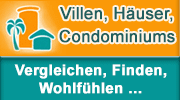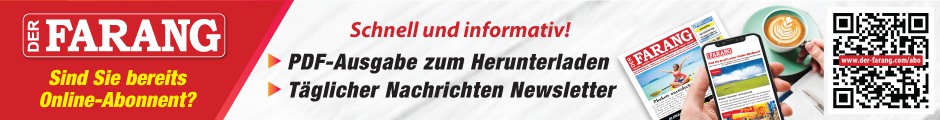«Stuttgarter Zeitung» zu Strafzöllen/China
Die EU stellt ihre Zölle als Akt eines fairen Handels dar - ist aber selbst nicht zimperlich, wenn es um Milliardensubventionen für den Bau von Batterie- und Chipfabriken geht.
Chinas Vorsprung ist ohnehin weniger auf Subventionen zurückzuführen als auf die kluge Entwicklung von Technologien und die strategische Sicherung von E-Rohstoffen. Anstatt sich in der Rolle des schlechten Verlierers einzurichten, sollte Europa sich auf seine Stärken besinnen. Dann wäre auch ein Platz auf der Überholspur drin.
«Handelsblatt» zu EU-Sonderzöllen auf chinesische E-Autos
FEST STEHT: Wehrhaft müssen nicht nur Demokratien sein, sondern auch Marktwirtschaften.
Und dass China seit Jahrzehnten eine unlautere Wettbewerbspolitik betreibt, bestreiten nicht einmal die größten Freihandelsapologeten und Peking-Freunde. Subvention und Protektion gehören zum Wesenskern des Staatskapitalismus chinesischer Fasson. Trotzdem - ein Unbehagen bleibt. Es stellt sich die Frage, ob die ökonomischen Risiken der EU-Vergeltungsstrategie am Ende nicht größer sind als der politische Nutzen, der sich aus dem emanzipatorischen Signal an Peking ergibt.
«Frankfurter Rundschau» zur Wehrpflicht
Die Diskussion über die Personalprobleme der Bundeswehr läuft unter dem Schlagwort "Wehrpflicht-Debatte" - dabei sollte klar sein, dass es keine Rückkehr zur Wehrpflicht geben darf, bei der alle 18-Jährigen zu einem Pflichtdienst verdonnert werden.
Die Bundeswehr benötigt nicht den Großteil eines Jahrgangs, sondern perspektivisch nur rund 20.000 Leute, überwiegend qualifiziertes Personal für zunehmend technische Aufgaben. Es ist angesichts der Spannungen in der Welt vernünftig, wenn möglichst viele Menschen sich darüber Gedanken machen, ob das für ihren Lebensweg infrage kommt. Ein Fragebogen an alle wehrfähigen Männer und Frauen kann dafür ein geeignetes Instrument. Das darf aber auf keinen Fall der erste Schritt zu einer neuen Wehrpflicht sein.
«Sydsvenskan»: Waffenstillstand - aber die Hamas muss weg
MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» kommentiert am Mittwoch einen möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen:
«Am Montagabend stimmte der UN-Sicherheitsrat für eine Resolution zum Waffenstillstand im Gazastreifen, wobei sich nur eines der 15 im Rat vertretenen Länder - Russland - der Stimme enthielt. Es wird gehofft, dass beide Parteien den von Präsident Biden Ende Mai vorgestellten dreistufigen «Friedensplan» annehmen werden.
Die Hamas-Führung erklärt, sie sei offen für eine Zusammenarbeit und die Erfüllung von Forderungen, die «mit unserem Volk und unserem Widerstand vereinbar sind». Die israelische Führung ist sich jedoch darüber im Klaren, dass die Terrorgruppe Hamas verschwinden muss, damit ein Frieden überhaupt denkbar ist.
Um die dritte und letzte Phase von Bidens Plan zu erreichen und mit dem Wiederaufbau des Gazastreifens zu beginnen, muss entweder die Hamas - die sich acht Monate lang geweigert hat, ihre Waffen niederzulegen, um die palästinensische Bevölkerung zu retten - jetzt ihre Niederlage eingestehen. Oder Israel muss vor den Terroristen kapitulieren. Diese würden damit für ihren blutigen Angriff vom 7. Oktober belohnt.
Die Beendigung dieses Krieges wird also große Kompromisse erfordern, wahrscheinlich zu große. Der Frieden liegt also noch in weiter Ferne.»
«El País»: Macrons riskante Wette
MADRID: Zur Lage in Frankreich nach der Europawahl-Pleite von Emmanuel Macron und der Ausrufung einer Neuwahl des Parlaments in Paris schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:
«Die Ausrufung einer Neuwahl zu einer Zeit, in der die Ultra-Partei (Rassemblement National) im Aufwind ist und unaufhörlich wächst, ist eine sehr riskante Wette. Es scheint nicht sehr wahrscheinlich, dass sich das (bei der Europawahl verzeichnete) Kräfteverhältnis in nur 20 Tagen umkehren wird (...) Mit Ausnahme von Paris und drei Departements in der Nähe der Hauptstadt ist Rassemblement National im Rest des Landes zur stärksten Partei avanciert. Seit den letzten Europawahlen hat sie 2,5 Millionen Wähler hinzugewonnen. (...)
Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hatte Macron den Franzosen versprochen, er werde die extreme Rechte ausrotten (...) Nach den Wahlen vom Sonntag sind jedoch die Rechtsextremisten von Rassemblement National der Macht in Frankreich, dem Motor der Europäischen Union neben Deutschland, näher denn je. Es bleibt nun abzuwarten, ob die Neuwahl des Parlaments wie ein Schutzwall oder wie eine Autobahn wirken wird.»
«Pravo»: Russland will Angst verbreiten
PRAG: In Europa häufen sich die Vorwürfe, Russland könnte hinter Sabotageakten und Brandanschlägen stehen. Dazu schreibt die Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Mittwoch:
«Mit einer Serie von Sabotageakten, Brandanschlägen und Cyberangriffen versuchen die russischen Geheimdienste, der westlichen Bevölkerung das Leben unangenehm zu machen. Großbritannien, die baltischen Staaten, Deutschland, Polen und nun auch Tschechien berichten von Fällen, die einzeln gesehen keine große Aufmerksamkeit hervorrufen würden. Im Kontext der russischen Drohungen (...) haben sie indes das Potenzial, für gesellschaftliche Unruhe zu sorgen. Dadurch könnte Druck auf die jeweiligen Regierungen entstehen, den russischen Bären lieber nicht zu reizen. (...) Es geht für Russland also nicht mehr darum, im Stillen und geheim Schäden zu verursachen, sondern darum, Angst zu verbreiten. Das gehört zum Metier des internationalen Terrorismus. Mit seinem Verhalten ordnet sich Russland immer stärker in die Kategorie der unberechenbaren Regime ein. Wenn Moskau Verhandlungen erreichen wollte, würde es genau das Gegenteil tun.»
«La Repubblica»: Le Pen ist reale Gefahr für Frankreich und Europa
ROM: Zur politischen Situation in Frankreich nach der von Präsident Emmanuel Macron angesetzten Parlamentsneuwahl schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:
«Die französische Pattsituation. Das ist die reale Gefahr, die mit einem möglichen Sieg von Marine Le Pens Rassemblement National bei den Wahlen Ende des Monats verbunden ist. Das Erstarken der reaktionären und antieuropäischen Rechten in Frankreich wird in der Tat nicht ohne Folgen für den Rest Europas bleiben. Die Alarmglocken in Brüssel schrillen bereits. Eine Regierung unter der Führung des Le Pen-Schützlings Jordan Bardella wäre ein Monsun, der einen Sturm der Ungewissheit über die nahe Zukunft der EU entfachen könnte. (...)
Die EU, in der Frankreich - einer der Motoren der europäischen Lokomotive - mit einem Streit zu kämpfen hat, der alle Energie verschlingen würde, müsste also mit einer noch nie dagewesenen "Einsamkeit" rechnen. Das deutsch-französische Bündnis, das traditionell an der Spitze der Union steht, würde in den Frostschrank der gemeinsamen Geschichte gestellt.
Die Parteien, die Le Pens RN nun gegenüberstehen, sind gespalten und zerstritten. Die Macron-Partei auf der einen und die Linke unter der Führung von Raphael Glucksmann auf der anderen Seite. Erstere handeln im Glauben, dass die Franzosen, um sich gegen die reaktionäre Rechte zu impfen, diese erst einmal in der Regierung am Werk sehen müssen. Letztere in der Hoffnung, nach der Katastrophe eine neue Front aufzubauen, um Glucksmann für die Präsidentschaftswahlen 2027 zu nominieren. Aber drei Jahre auf die Erlösung zu warten, ist für alle eine zu hohe Belastung. Für die Franzosen und für die Europäer.»
«The Irish Times»: EU braucht einen einheitlichen Kapitalmarkt
DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» plädiert am Mittwoch für schnellere Fortschritte bei der Schaffung einer Kapitalmarktunion in der EU:
«Man kann wohl davon ausgehen, dass die Kapitalmarktunion in der EU bei den Wahlen zum Europäischen Parlament nicht für allzu viele Wähler an erster Stelle stand. Die Vollendung der Europäischen Währungsunion ist jedoch von entscheidender Bedeutung, wenn die EU ihr wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen will. (...)
Die Argumente für die Kapitalmarktunion sind überzeugend. Die EU hat eine ehrgeizige Wachstumsagenda, zu der auch die Nutzung der Chancen der digitalen Wirtschaft und der Übergang zu einer grünen Wirtschaft gehören. Aber wie es aussieht, fällt die EU hinter die USA und China zurück. Die Kapitalmarktunion hat das Potenzial, in der gesamten EU Milliarden an privatem Kapital freizusetzen, was das dringend benötigte Wirtschaftswachstum ankurbeln würde.
Ursula von der Leyen, die eine zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission anstrebt, hat die Kapitalmarktunion zu einer ihrer Prioritäten erklärt. Es ist zu hoffen, dass sie diese Zusage einhält und die Kapitalmarktunion noch in der nächsten Legislaturperiode Realität wird.»
«NZZ»: Gefühlsmäßig ist die Ampel abgewählt
ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das Abschneiden der SPD bei der Europawahl:
«Das Ergebnis der Europawahl ist ein Desaster für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und ihren Bundeskanzler Olaf Scholz. Die älteste Partei des Landes kam nicht auf 40 Prozent wie einst mit Gerhard Schröder, nicht auf 25 Prozent wie noch bei der Bundestagswahl 2021, sondern lediglich auf 13,9 Prozent der Stimmen. (.)
Es war ein Untergang mit Ansage, und der Plan, der in den Abgrund führte, trägt, für jedermann erkennbar, die Handschrift von Olaf Scholz. Dieser Kanzler scheint, was immer er von sich selbst glauben oder andere glauben machen mag, politisch nie wirklich über das Format eines stellvertretenden Juso-Vorsitzenden hinausgewachsen zu sein. (.)
Die AfD, deren Spitzenkandidaten vor der Wahl in Skandale verstrickt waren und die innerhalb der europäischen Rechten isoliert ist, erhielt mit fast 16 Prozent eindeutig mehr Zuspruch als die Kanzlerpartei. Insgesamt ergibt sich ein Lagebild, in dem die deutsche «Fortschrittskoalition» aus SPD, Grünen und FDP nur mehr 30 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Gefühlsmäßig ist sie abgewählt.»
«De Tijd»: Politische Instabilität treibt Anleihezinsen in die Höhe
BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Mittwoch die Reaktion der Finanzmärkte auf die Ansetzung von Parlamentsneuwahlen in Frankreich nach dem Erfolg von Marine Le Pens Partei bei der Europawahl:
«Den zweiten Tag in Folge wurden die Finanzmärkte am Dienstag durch den Aufstieg der Rechtsextremen in Frankreich verunsichert. Am Sonntag hatte das Rassemblement National von Marine Le Pen bei den Europawahlen ein historisches Ergebnis von 31 Prozent erzielt. Daraufhin kündigte Präsident Emmanuel Macron vorgezogene Parlamentswahlen an. (...)
Das reichte für so manchen «Angstverkauf». Französische Staatsanleihen erlebten ihre schlimmste zweitägige Talfahrt seit der Pandemie. Danach erholten sich die Kurse zwar etwas. Dennoch ist die Rendite für französische Staatsanleihen zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren höher als die für belgische.
Dies zeigt, dass politische Instabilität buchstäblich ihren Preis hat. Frankreich hat noch einiges zu tun, um seine Staatsverschuldung von mehr als drei Billionen Euro abzubauen und seine finanzielle Anfälligkeit zu verringern. Je größer die Ungewissheit darüber ist, ob das Land über die nötige politische Schlagkraft verfügt, um diese Aufgabe zu bewältigen, desto schneller werden sich Anleger aus französischen Anleihen zurückziehen und damit die Rendite in die Höhe treiben.»
«Washington Post»: Der Präsidentensohn steht nicht über dem Gesetz
WASHINGTON: Zu dem Schuldspruch gegen US-Präsidentensohn Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes merkt die «Washington Post» am Mittwoch an:
«Niemand steht über dem Gesetz, nicht einmal der Sohn des Präsidenten. Die Verurteilung Hunter Bidens am Dienstag vor einem Bundesgericht in Delaware entkräftet die Behauptung des früheren Präsidenten Donald Trump, seine Verurteilung in New York habe gezeigt, dass das Justizsystem manipuliert sei. Und die Verurteilung unterstreicht, wie wichtig es ist, die wenigen Waffenkontrollgesetze strikt durchzusetzen, die dieses Land hat. (...)
Es hätte nie so weit kommen dürfen. Hunter Biden hätte seiner Familie und dem Land das Spektakel seines Prozesses ersparen können, wenn er sich schon vor langer Zeit schuldig bekannt, die volle Verantwortung übernommen und das Gericht bei der Verurteilung um Gnade gebeten hätte. Stattdessen haben er und seine Anwälte versucht, eine ungewöhnliche Vereinbarung zu erzielen, die Biden weitreichende Immunität vor strafrechtlicher Verantwortung bringen sollte. Diese scheiterte vergangenes Jahr an der berechtigten Kritik des Bundesrichters in diesem Fall.
In einem Bundesstaat, wo seine Familie zur politischen Elite gehört, hatte Biden eindeutig auf eine Aufhebung des Urteils durch die Jury oder auf ein paar Unentschlossene gehofft, die sein Kampf mit der Sucht bewegt. Glücklicherweise hat die Jury ihre Pflicht getan.»