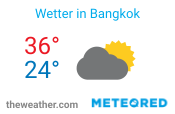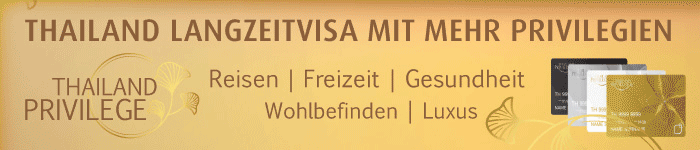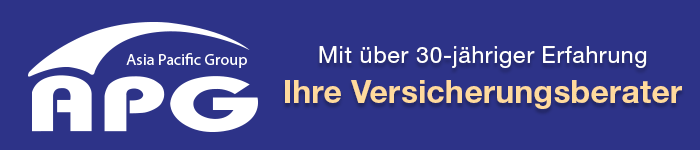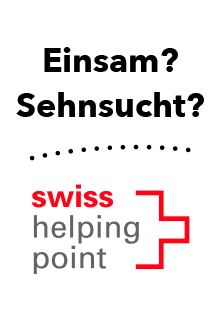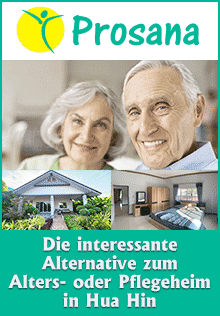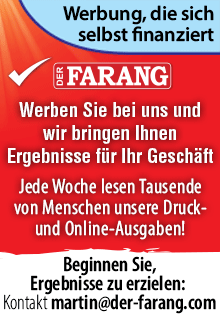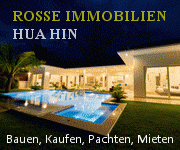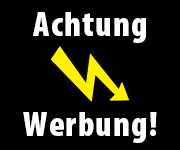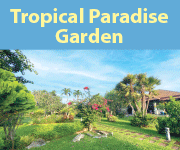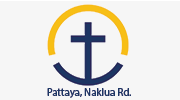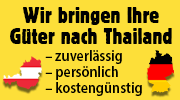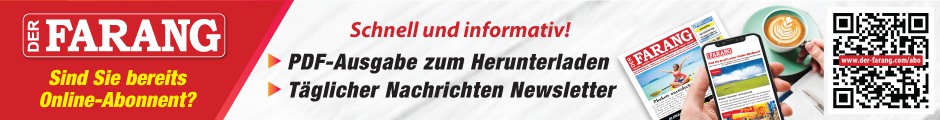«Stuttgarter Zeitung» zu Organspenden/ Widerspruchsregelung
Die Widerspruchsregelung würde zumindest dazu führen, dass es mehr mögliche Spender gibt.
Doch der Schlüssel zu mehr tatsächlichen Spenden liegt in den Kliniken, in denen es - aus Arbeitsüberlastung, Personalmangel und Anreizen - am Spendenmanagement fehlt. Dennoch ist die Widerspruchslösung der falsche Weg. In keinem anderen Lebensbereich wird ein Schweigen als Zustimmung gewertet. Es gibt viele Gründe, nicht zu einer Entscheidung zu kommen. Der Unwille, sich mit dem Sterben zu beschäftigen, mag dazugehören. Aber es gibt Menschen, die mit sich ringen: Sei es aus religiösen Vorbehalten, dem Abscheu, sich den Körper als ausgeweidet vorzustellen, oder aus Angst. NRW-Minister Laumann sagt, die Organspende sei ein Liebesbeweis an die Menschheit. Er hat recht. Und Liebe lässt sich nicht herbeizwingen.
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Trauerfeier in Mannheim
Er schützte die Freiheit - und starb dafür.
(.) Die für jedermann sichtbare Messerattacke durch einen ehemaligen Asylbewerber aus Afghanistan mit offenbar islamistischem Hintergrund traf einen Polizisten aus Leidenschaft (.). Rouven Laur, dem Tausende Kameraden das letzte Geleit gaben und seiner in ganz Deutschland gedachten, bleibt unter uns. Denn das Gedenken an ihn ist fortwährender Auftrag. Dieser Auftrag, das gedeihliche Zusammenleben in Deutschland in Freiheit und Frieden zu sichern, hat viele Facetten. (.) Dass auch große Freiheit Grenzen hat, haben muss, müssen nicht nur Neuankömmlinge lernen, sondern auch Einheimische leben. (.) Rouven Laur schützte wie Tausende andere den freiheitlichen, friedlichen Diskurs, in dem der Andersgläubige kein Feind ist. (.) Es muss sich etwas ändern. In seinem Sinne.
«Münchner Merkur» zu Merz/Wagenknecht
Mit seiner Absage an Koalitionen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich Friedrich Merz keine Freunde gemacht, schon gar nicht im Osten der Republik, wo die CDU nicht geschmäcklerisch bei der Auswahl ihrer Mehrheitsbeschaffer sein darf.
Entsprechend zornig fielen die Reaktionen der Wahlkämpfer in Thüringen und Sachsen aus, weshalb der CDU-Chef jetzt den Teilrückzug antreten musste. Mit Blick auf die Bundesebene aber hat er erfrischend deutlich das Richtige gesagt. Hinter der telegenen Erscheinung der schönen und wortmächtigen roten Sahra verbirgt sich eine Demagogin, die an den Säulen der Republik rüttelt, nämlich ihrer Westbindung und der marktwirtschaftlichen Ordnung. Eine Partei, die den Kniefall vor dem totalitären Kremlherrscher Putin übt und in schamloser Täter-Opfer-Umkehr die Ukraine zum Aggressor und Sicherheitsrisiko für Deutschland erklärt, hat in einer Bundesregierung nichts verloren.
«Politiken»: Die deutsch-französische Achse befindet sich in der Krise
KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» kommentiert am Freitag die anstehenden Neuwahlen in Frankreich:
«Sollten die französischen Wahlen mit einer Regierungsbildung der Nationalisten von Marine Le Pen enden, könnte es zu einem lähmenden Wettlauf mit Präsident Macron kommen. Und es wird sehr stark um die französische Führungsrolle in der Ukraine gehen, die Emmanuel Macron schließlich übernommen hat. Es steht viel auf dem Spiel. Wenn die Unterstützung der EU für die Ukraine gegen die russische Aggression scheitert, hat die EU ihre sicherheitspolitische Rolle praktisch ausgespielt.
Ein französischer Präsident hat umfassende sicherheitspolitische Befugnisse, aber nicht alle. Und die Partei von Marine Le Pen wird ein zweifelhafter Partner sein. Sie hat in der Vergangenheit fragwürdige Beziehungen zu Russland unterhalten.
Die europäische Verwirrung wird durch die Tatsache verstärkt, dass der deutsche Bundeskanzler, der Sozialdemokrat Olaf Scholz, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament auch von der extremen Rechten eine Klatsche erhalten hatte.
Die deutsch-französische Achse, die in der Vergangenheit die Zusammenarbeit in der EU beflügelt hat, befindet sich zu einem historisch anfälligen Zeitpunkt in der Krise.»
«La Vanguardia»: Die EU, China und die Zölle
BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die von der EU angedrohten Strafzölle auf chinesische E-Autos:
«(...) Die EU-Kommission erwägt, weitere Zölle (bisher schon 10 Prozent) auf chinesische Elektroautos zu erheben (...). Hierfür gibt es mehrere Gründe. Der erste ist, dass die Regierung in Peking angeblich Dumping betreibt (...). Der zweite ist die kontinuierliche Zunahme dieser Einfuhren. Die Kommission verhandelt derzeit mit den chinesischen Behörden(...). Handelskriege wirken sich selten nur auf eine Seite aus. Wenn ein Land Sanktionen gegen ein anderes verhängt, antwortet dieses in der Regel in gleicher Währung. Peking hat bereits angedeutet, dass es Zölle auf Importe europäischer Hersteller wie Mercedes und BMW erheben könnte.
Diese Auseinandersetzungen finden in einem besonderen wirtschaftlichen Kontext statt. China ist bereits der weltweit größte Hersteller von Elektroautos und kontrolliert einen sehr großen Anteil der Batterieproduktion. (...) Es liegt also auf der Hand, dass sich der Kampf um den Zukunftssektor verschärft (...). Die EU muss eine Reindustrialisierung und strategische Autonomie anstreben. Sie muss bedenken (...), dass Pakte gewinnbringender sein können als Konfrontationen. Und in jedem Fall sollten Entscheidungen im Einklang mit den von der Welthandelsorganisation festgelegten Grundsätzen getroffen werden.»
«The Guardian»: Labour profitiert von Unzufriedenheit mit den Tories
LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag das von Labour-Parteichef Keir Starmer präsentierte Programm für die britische Parlamentswahl am 4. Juli:
«Das Wahlprogramm bietet große Ideen - Ideen, die nach den Jahren konservativer Regierungen noch größer klingen. Der Wiederaufbau eines zerrütteten Landes. Ein völliger Richtungswechsel. Langfristig statt kurzfristig. Ein gerechteres und gesünderes Land. Ein Land, das den arbeitenden Menschen zu Diensten ist.
Wenn Worte alles wären, hätten Sir Keir und seine Partei bereits gewonnen. Das Programm ist gut strukturiert und logisch aufgebaut, und seine Sprache ist konzentriert. Es geht auf Themen ein, die von der Reform des staatlichen Gesundheitsdienstes über den Musikunterricht bis zur Reform des Oberhauses reichen. Aber es gibt keine Antwort auf die übergreifende Frage, ob Labour in der Lage ist, seine Agenda des Wandels tatsächlich zu verwirklichen. (...)
Viel hängt von der Fähigkeit der Labour-Partei ab, die Wirtschaft zu überzeugen, sich anders zu verhalten, als sie es bisher gewohnt war. Das wird nicht einfach sein, um es vorsichtig auszudrücken, insbesondere wenn Europa und die USA nach rechts rücken. Sir Keir muss seine Wähler auch in wirtschaftlich stagnierenden Zeiten bei der Stange halten. Der derzeitige Vorsprung von Labour in den Umfragen ist groß. Aber er scheint mehr auf Unzufriedenheit mit den Tories als auf Begeisterung für Labour oder Sir Keir persönlich zu beruhen.»
«De Telegraaf»: Strafzölle könnten zu Handelskrieg mit China führen
AMSTERDAM: Zur Drohung der EU-Kommission mit Strafzöllen auf E-Autos aus China meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:
«Nach Ansicht der EU-Kommission ist dies notwendig, weil Autos in China dank der Unterstützung durch den Staat billiger gebaut werden. Diese staatliche Hilfe bedeute, dass europäische Hersteller verdrängt werden, und das sei nicht fair, argumentiert Brüssel. Das klingt logisch, aber dennoch gibt es (auch innerhalb Europas) Widerstand gegen die Maßnahme. Die Meinungen über das Ausmaß der staatlichen Beihilfen in China gehen auseinander.
Auch europäische Hersteller, die in China Autos bauen, wären von den Sonderzöllen betroffen, und schließlich - so argumentiert die deutsche Autoindustrie - sollte Europa auf sich selbst schauen und billiger produzieren, anstatt sich hinter Zollmauern zu verschanzen.
Die nächsten Monate werden zeigen, ob die Brüsseler Pläne von den Mitgliedsstaaten ausreichend unterstützt werden. Sollten die zusätzlichen Abgaben durchkommen, ist ein Handelskrieg mit China nicht zu vermeiden. Das würde die europäische Wirtschaft und damit auch die der Niederlande treffen.»
«Corriere della Sera»: Von China ist das Schlimmste zu befürchten
MAILAND: Zur Drohung der EU-Kommission mit Strafzöllen auf E-Autos aus China und der möglichen Gefahr eines Handelskriegs schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:
«Wirtschaft und Geopolitik vertragen sich nicht gut. Die scheidende Europäische Kommission ist besorgt über die Einfuhren von in China hergestellten E-Autos. In Europa wird der Kauf letzterer stark gefördert. Diese erhöhte Nachfrage - genau das wollte die Kommission. Aber es handelt sich um chinesische Autos, und das wollte die Kommission überhaupt nicht. Daher die Drohung der drastischen Erhöhung der Strafzölle gegen China, auch wenn diese nicht das US-Niveau erreichen. Die EU hat dies anders gerechtfertigt als die USA und damit versucht, ihre eigenen Regeln nicht für einen geopolitischen Juckreiz zu opfern.
Die Strafzölle wären eine Vergeltungsmaßnahme für die von Peking verteilten Subventionen. Nun ist das Schlimmste zu befürchten: Die Chinesen könnten die Subventionen im Gegenzug erhöhen, sodass die Preise trotzdem gleich blieben. So fangen Handelskriege an. (...) Der EU-Protektionismus soll eigentlich dazu dienen, den europäischen Herstellern Zeit zu verschaffen, um wieder in Schwung zu kommen. Aber wird es wirklich dazu kommen?»
«Star Tribune»: US-Richterentscheid zu Abtreibungspille reicht nicht
MINNEAPOLIS: Das Oberste Gericht der USA hält den Zugang zu der weit verbreiteten Abtreibungspille Mifepristone aufrecht und hat am Donnerstag eine Klage von Abtreibungsgegnern abgewiesen. Dazu schreibt die «Star Tribune»:
«Die neun Richter entschieden einstimmig gegen eine wenig bekannte Organisation von Abtreibungsgegnern, die sich gegen die Zulassung von Mifepristone durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sowie gegen Maßnahmen der Behörde zur Erleichterung des Zugangs von Patienten zu Mifepristone richtete. Die Entscheidung ist zu begrüßen, aber sie schließt nicht die Tür für künftige Anfechtungen dieses Medikaments oder anderer, die üblicherweise in Kombination mit ihm für medikamentöse Abtreibungen verwendet werden (...).
Gesetze wie das 2023 von Senatorin Tina Smith aus Minnesota eingeführte zum Schutz des Zugangs zu medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen sind nach wie vor dringend erforderlich. Der Grund: Die neun Richter entschieden nicht über die dem Fall zugrundeliegenden Fragen zur Zulassung des Medikaments (...) Stattdessen konzentrierte sich die Entscheidung auf die Klagebefugnis der Kläger. (...) Auch wenn die Entscheidung beruhigend ist, hilft sie den Frauen in 14 Bundesstaaten mit weitreichenden Abtreibungsbeschränkungen (...) nicht. Im Idealfall würde der US-Kongress ein Gesetz verabschieden, das den Schutz der Abtreibung festschreibt.»