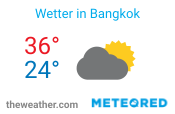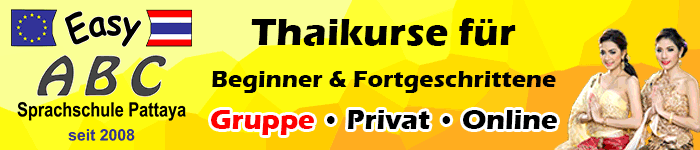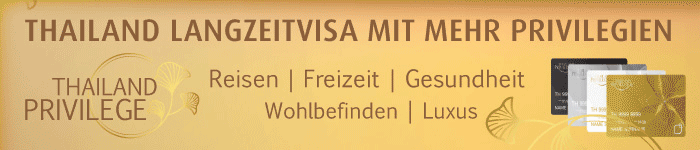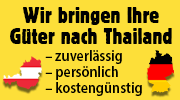Eine Überraschung ist es nicht: Vor einigen Tagen hat die Europäische Zentralbank (EZB) angekündigt bis September 2016 monatlich 60 Milliarden Euro für den Ankauf von Staatsanleihen auszugeben. Insgesamt liegt das Volumen der Maßnahme damit bei rund 1.140 Milliarden Euro. Angeblich sei das Geld erforderlich, um Deflationsgefahren zu bekämpfen (eine Spirale fallender Preise). In der Realität sind allerdings keine Anzeichen einer Deflation auszumachen. Zuletzt stiegen die Preise für Verbrauchsgüter um 0,7 Prozent pro Monat.
Um den Gegnern des Programms die Speerspitze zu nehmen, hat sich Mario Draghi, Chef der EZB, schlau darauf eingelassen, die nationalen Notenbanken zunächst nur Anleihen ihrer eigenen Staaten aufkaufen zu lassen. Sollte folglich eine Regierung der Problemstaaten ihre Schulden nicht bedienen können, so betrifft das unmittelbar nicht andere Staaten der Eurozone. Klar muss allerdings sein, dass jede Pleite eines größeren Mitgliedsstaates der Eurozone alle europäischen Banken, Versicherungen, Investoren und Unternehmen empfindlich treffen würde. Der praktische Wert des Zugeständnisses ist daher mehr als zweifelhaft.
Das letzte Pulver verschießen
Die Notenbanker der deutschsprachigen Länder sehen die Entscheidung skeptisch. So hat beispielsweise Österreichs oberster Notenbanker, Ewald Nowotny, dem Programm nicht zugestimmt. Auf Anfrage hat er erklärt, in seinen Augen gäbe es derzeit keine Veranlassung, das letzte Pulver zu verschießen. Recht hat er.
Die Schweiz hat bereits bei der Ankündigung der jüngsten EZB-Pläne die Notbremse gezogen: Vor dem Hintergrund der immer weiteren Lockerung der EZB-Geldpolitik, hat die SNB (Schweizer Nationalbank) überraschend den Wechselkurs des Franken freigegeben und damit die Bindung der Schweizer Währung an den Euro aufgehoben. Diese Entscheidung dürfte den Verantwortlichen nicht leicht gefallen sein, da sie die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft und der Tourismusindustrie nicht unerheblich schwächt. Die angekündigte Entscheidung der EZB nun, hätte die Eidgenossen dazu gezwungen, ihre Geldbasis weiter aufzublähen, Das wollten die Banker wohl nicht verantworten. Ob diese Entscheidung richtig oder falsch war, wird davon abhängen, wo sich der Schweizer Franken in den nächsten Wochen und Monaten einpendeln wird.
Für alle deutschsprachigen, die im Ausland leben, das nicht zur Eurozone gehört, dürften sich die Wege nun trennen. Während die Entscheidung der Schweizer Notenbank den Franken dauerhaft aufwerten dürfte, wird die Entscheidung der EZB den Euro dauerhaft drücken. Goldmann Sachs beispielsweise sieht den Euro in einem Jahr bei nur noch 0,9 USD. Eine durchaus realistische Einschätzung. Die Exportwirtschaft wird dieses Szenario nicht ungern sehen, erleichtert es doch den Absatz der eigenen Produkte. Die Befürworter des EZB-Programms verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf neu entstehende Arbeitsplätze. Dies ist in der Theorie auch richtig – der einzelne Bürger der Eurozone hat jedoch nur etwas davon, wenn diese Arbeitsplätze auch in seiner Region entstehen.
Der Euro wurde zur Weichwährung
Aus der Perspektive des mündigen deutschen Bürgers könnte einem schon mulmig werden. Jahrzehntelang hatten die Deutschen ein inniges Verhältnis zu ihrer D-Mark, die seit den Jahren des Wirtschaftswunders beinahe identitätsstiftend wirkte. Die starke Währung zwang einerseits die Wirtschaft zu Spitzenleistungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ermöglichte es den Ottonormalverbrauchern schöne Urlaube für wenig Geld bei unseren Nachbarn zu machen. Mit ungläubigem Staunen nahm beispielsweise der treue Italientourist zur Kenntnis, dass die Lira über die Jahre immer weniger wert wurde. Kaum jemand verschwendete jedoch einen Gedanken daran. Es betraf einen ja nicht. Heute liegen die Dinge jedoch anders. Mario Draghi macht den Euro zu einer Weichwährung. Die bisher solide wirtschaftenden Staaten der Eurozone lassen zu, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt und scheinen die langfristigen Konsequenzen dieser Haltung zu verdrängen.
Zum Schluss noch ein positiver Aspekt der gegenwärtigen Entwicklung: Aus medizinischer Sicht brauchen sich die Sparer in der Eurozone jedenfalls keine Sorgen zu machen! Die Billionenspritze geht keinesfalls in ihren Hintern!