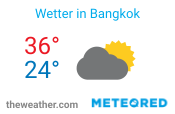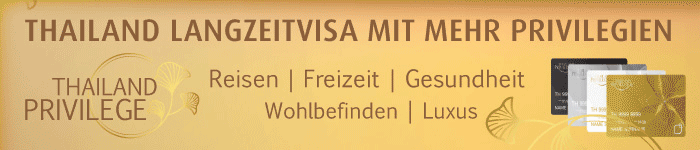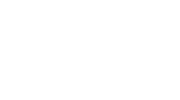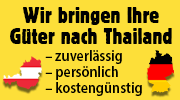HANNOVER/MAGDEBURG: Dass Sprache eine Waffe sein kann, wissen die meisten. Dass die Sprache selbst oft kriegerisch daherkommt, fällt aber vielen kaum auf. Was sagt das über uns? Müssen wir angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zumindest sprachlich abrüsten?
Da spricht man unbefangen davon, einen «Schlachtplan» zu schmieden, man überlegt, ob eine Idee «kriegsentscheidend» sein kann - oder man befürchtet «verhärtete Fronten». Auch freut man sich über «Bombenstimmung», ob im Biergarten oder im Fußballstadion. Sind wir so kriegerisch, verrät die Sprache am Ende Regungen, die wir längst überwunden glaubten - bis Kreml-Herrscher Wladimir Putin die Ukraine grausam überfiel? Ganz so ist es nicht, betont Experte Mark Dang-Anh vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim: «Man kann nicht pauschal unterstellen, dass es einen strategischen Gebrauch von Kriegsmetaphern gibt.»
Denn, so erklärt es der Sprachwissenschaftler und Medienlinguist, Sprache dient dazu, uns in der Welt einzurichten und sie zu verstehen. Dabei helfen eben Metaphern, bildhafte Beschreibungen, Übertragungen und Analogien: «Wenn wir uns Neues erschließen, greifen wir gern auf bekannte Muster zurück.» Solche Sprachbilder könnten sich verfestigen, bis dem Sprecher nicht einmal mehr bewusst sei, in Metaphern oder auch sogenannten Metonymien zu sprechen. So habe «Kopf» ursprünglich «gewölbte Schale» oder «Schöpfgefäß» bedeutet und wurde aufs menschliche Haupt übertragen.
Der «Hiwi» wiederum, der Hilfswissenschaftler an der Uni, war im Zweiten Weltkrieg noch der «Hilfswillige» an der Ostfront. Der Krieg hat die Deutschen geprägt. Aber: Eine Kriegsmetapher zu verwenden bedeute nicht zwingend, dass der Sprecher etwas «besonders martialisch» darstellen wolle, erklärt Dang-Anh.
Es sei schwer zu beurteilen, ob dieser Sprachgebrauch mit dem früheren deutschen Militarismus zu tun habe, urteilt Dirk Schumann, Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Göttingen. Es müsse systematisch geprüft werden, ob diese Begriffe auch in anderen Sprachen verwendet würden.
Tatsächlich gebe es Kriegsmetaphern auch etwa im Englischen und Französischen, sagt die Germanistin und Linguistin Kristin Kuck von der Universität Magdeburg. Aber es sei nur im konkreten Kontext möglich zu sagen, ob eine Kriegsmetapher problematisch sei oder nicht, der Gebrauch sei «nicht per se kriegerisch gemeint und verwerflich». Im Moment des Krieges aber, wie er gerade in der Ukraine tobt, nehmen wir ihren Worten zufolge solche Metaphern eher wahr, diese «archaische Vorstellung von Krieg und Kampf, die wir normalerweise nur als Quell für Metaphern benutzen». Plötzlich werde die wörtliche Bedeutung mitgedacht.
Die Idee, kriegerische Metaphern aus der Sprache zu verbannen, hält sie für unmöglich; es sei ein «ganz normales und auch sehr produktives Verfahren, solche Metaphern zu bilden», sagt Kuck. «Wir können nicht einfach nur wörtlich sprechen, weil ein großer Teil unseres Sprachgebrauchs metaphorisch ist.»
Allenfalls gingen wir angesichts des Ukraine-Krieges «etwas sensibler» mit Sprache um, wie Dang-Anh sagt. Schumann betont, viel mehr störe ihn in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine der immer stärkere Gegensatz zwischen Pazifismus und Bellizismus - der Kriegsverherrlichung. Das sei eine «polemische und nicht angebrachte Verzerrung».
Fest steht: Metaphern aus der Welt von Krieg und Kampf dienen oft dazu, strategisches Vorgehen auszudrücken. «Das bedeutet aber nicht, dass wir jeweils auch die Idee der Gewalt mit übertragen», mahnt Kuck. «Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich einen Schlachtplan entwickle, dann wird mir kaum jemand unterstellen, dass ich gewaltbereit bin.»
Tatsächlich ist der Gebrauch der kriegerischen Metaphern längst nicht immer problematisch, sagt die Expertin. Beispiel Sport - etwa im Fußball oder eigentlich immer, wenn es um Konfrontation oder ein Konkurrenzverhältnis geht, wie Kuck sagt. Schaut man sich die Fußballsprache an, findet man Stürmer und Verteidiger, die Spieler «erobern» den Ball, es gibt Mittelfeld-Strategen, Offensive und Defensive, die Abwehr steht bombenfest, man will hinter die feindlichen Linien und vor allem will man gewinnen. Eigentlich alles ganz normal.
Ein anderes Beispiel: die Wirtschaft. «Das ist eine andere Art von Kampf», sagt Kuck. Aber die Kriegsmetaphern finden sich auch dort, wenn sich ein Unternehmen gegen andere durchsetzt oder ein Geschäftsfeld erobert - das sei «fast schon territorial». Denn wenn über wirtschaftliche Zusammenhänge gesprochen werde, stecke das Konzept des Erfolgs dahinter - und Erfolg habe immer etwas mit der Frage des Gewinnens oder Verlierens zu tun.
Und manchmal ist der fast verloren gegangene zynische Tonfall, wenn man etwa vom für viele erfreulichen «Bombenwetter» spricht, plötzlich wieder da. Denn wenn Bomben fallen, bezeichnet der Begriff eben «kein Wetterphänomen» mehr, wie Kuck sagt. «Da wird der Zynismus plötzlich bewusst.» Und das erst recht, wenn es um eine schwächere Gruppe geht - etwa Kriegsflüchtlinge. «Dann könnte eine Verwendung von Kriegsmetaphern in den Kontext schon wieder zynisch klingen. Und dann könnte man das kritisch hinterfragen.» Das stelle die Kriegsmetaphern aber nicht komplett in Frage, sondern im konkreten Fall.
Und nicht immer drehen sich Metaphern um Kampf und Krieg, sie seien ein Phänomen der Alltagssprache, sagt Kuck. Beispiel Wasser: Die Bewegung des Fließens werde auch auf Geld übertragen - so spricht man von Geldflüssen oder Finanzströmen.
Der Ursprung vieler Metaphern sei oft nicht einmal mehr vertraut, sie dienen dem gemeinsamen Verstehen. Die Bedeutung der Redewendung «jemanden durch den Kakao ziehen» dürften die meisten kennen - wörtlich nehmen würde das vermutlich aber niemand.