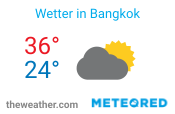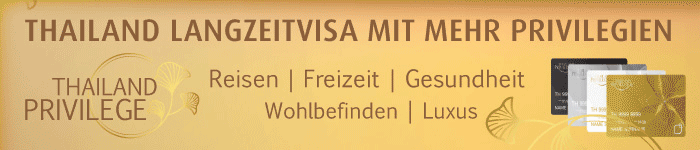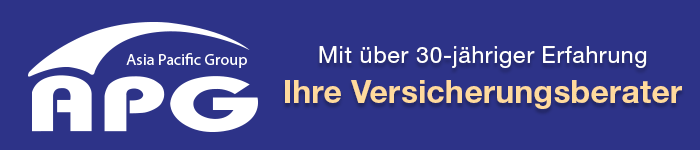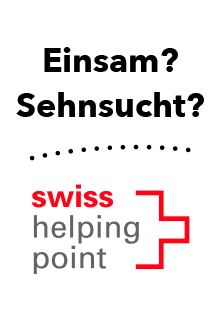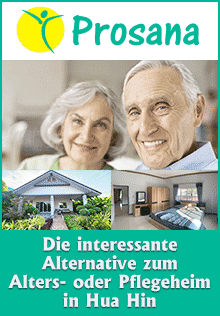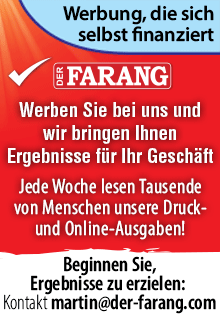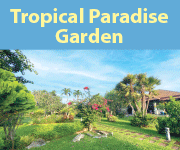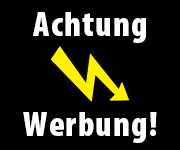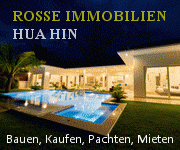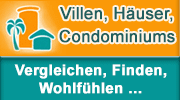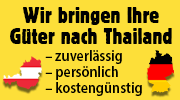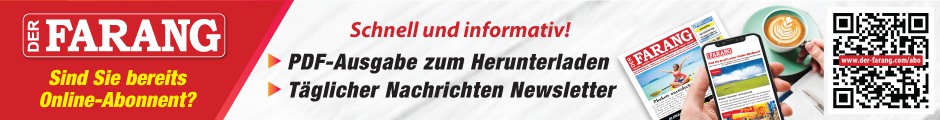Raumfahrtfirmen schließen sich Initiative gegen Weltraummüll an
BERLIN: Dutzende Unternehmen und Organisationen der Raumfahrtbranche schließen sich den Bemühungen der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zur Vermeidung von Weltraummüll an. Auf der Internationalen Luft - und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin unterzeichneten sie am Donnerstag die sogenannte Zero Debris Charta. Die Charta soll hin zur kompletten Vermeidung von Rückständen im Weltraum führen und bis 2030 das Entstehen von Weltraummüll in den Umlaufbahnen von Erde und Mond drastisch einschränken. Unter den Unterzeichnern sind der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, Airbus Defence and Space und Thales Alenia Space.
«Die Zukunft unserer wertvollsten und wichtigsten Raumgüter zu schützen, indem wir die Umlaufbahnen der Erde frei von Trümmern halten, ist entscheidend», sagte Esa-Chef Josef Aschbacher. In den vergangenen zwei Jahren wurden der Esa zufolge mehr Satelliten ins All geschickt als in den sechs Jahrzehnten zuvor. Mehr Weltraumschrott könnte komplette Umlaufbahnen unnutzbar machen. «In den letzten Jahren ist die Zahl von Trümmern im All rasant gestiegen, was das Risiko von katastrophalen Schäden für Weltraumgüter erhöht», sagte der Esa-Programmleiter für Weltraumsicherheit, Holger Krag.
Die Esa hatte die Charta im vergangenen November veröffentlicht. Kürzlich unterzeichneten auch Deutschland und weitere Esa-Mitgliedstaaten die Charta.
Raketensystem «Starship» zu viertem Teststart aufgebrochen
BROWNSVILLE: Mit einer Gesamthöhe von 120 Metern ist das «Starship» von Elon Musk größer als die Freiheitsstatue. Zwei Tests liefen anders als erhofft - jetzt ist ein vierter gestartet.
Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte ist nach drei nicht erfolgreich abgeschlossenen Anläufen zu einem vierten Testflug aufgebrochen. Das unbemannte «Starship» hob am Donnerstag vom Weltraumbahnhof des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk im US-Bundesstaat Texas ab, wie Live-Bilder zeigten. Vorgesehen war ein rund einstündiger Testflug.
Bei einem ersten Test im vergangenen April war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Bei einem zweiten Test im November hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide separat explodiert. Bei einem dritten Testflug im März erreichte das «Starship» erstmals das All, konnte den Flug jedoch ebenfalls nicht wie erhofft abschließen. SpaceX betont stets, dass das Ziel der Tests ist, Daten zu sammeln.
Das «Starship» - bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster «Super Heavy» und der rund 50 Meter langen ebenfalls «Starship» genannten oberen Stufe - soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Das System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können. Das insgesamt rund 120 Meter lange System soll künftig weit über 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mit dem «Starship» will die Nasa Astronauten auf den Mond bringen. SpaceX hofft, mit dem System eines Tages bis zum Mars zu kommen.
Sieben deutsche Firmen unter 100 vielversprechenden Start-ups
GENF: Deutschland ist in einer neuen Liste mit rund 100 vielversprechenden Start-ups in der Tech-Industrie mit mehreren Firmen vertreten: Zwar führen die USA die Liste mit großem Abstand an, aber nach den USA, China und Indien kommen die meisten Start-ups darauf aus Deutschland. Die Liste hat Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) am Donnerstag veröffentlicht.
Die sieben deutschen Firmen sind: ConstellR aus Freiburg im Breisgau, HelloBetter aus Hamburg, Made of Air aus Berlin und aus München Marvel Fusion, Proxima Fusion und UNIO Enterprise sowie Plan QC aus Garching. Aus den USA sind mehr als 35 Firmen gelistet, aus China elf und aus Indien zehn. Insgesamt kommen die Firmen aus 23 Ländern, darunter Israel, Brasilien, Kenia und Ägpyten. Ein Drittel werde von Frauen geführt, hieß es.
Viele der Firmen seien mit der Anwendung Künstlicher Intelligenz zur Lösung von Problemen in den Bereichen Energie, Gesundheit, Biotechnologie, Raumfahrt und Neurotechnologie beschäftigt, berichtete das WEF. Es wählt die Start-ups aus und vernetzt sie mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um Probleme der Menschheit und des Planeten lösen zu helfen. «Sie sind die Topadressen für Innovation, die die digitale Welt voranbringen und die globalen Trends von morgen prägen», so das WEF.
«Diese Innovatoren nutzen die fortschrittlichsten Technologien, um die radikalen Veränderungen voranzutreiben, die zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Welt notwendig sind», zitierte das WEF die zuständige Abteilungsleiterin Verena Kuhn.