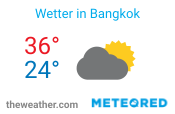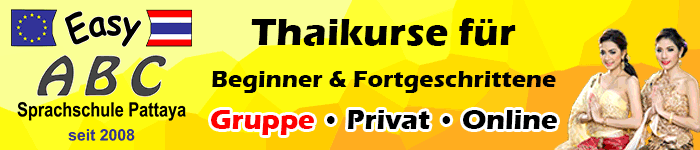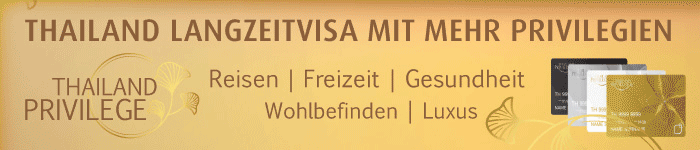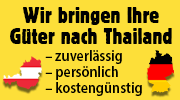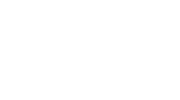KABUL: Am 15. August 2021 fiel nach einer Blitzoffensive der Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul an die Islamisten. Der Krieg ist vorbei. Die Menschen müssen nun an ganz anderen Fronten kämpfen.
Die afghanische Hauptstadt Kabul war über viele Jahre vor allem eines: laut. Verkehr ohne Ende. Straßenhändler, die ihre Waren anpriesen. Mädchen mit weißen Kopftüchern, die kichernd in großen Gruppen aus der Schule nach Hause liefen. Abends schallte Hochzeitsmusik aus grell beleuchteten Hochzeitshallen durch die Stadt. Auch andere Geräusche gehörten zum Alltag: Gewehrfeuer, Handgranaten oder der jähe Knall, wenn sich wieder ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. «Heute ist es viel ruhiger», erzählt der Student, der sich Enajat Nadschib nennt, am Telefon. «Weniger Menschen auf der Straße, weniger Frauen - irgendwie ist die ganze Energie weg.»
Zwei Jahre ist es nun her, dass mit dem Abzug der internationalen Truppen und nach einer Blitzoffensive der Taliban am 15. August Kabul wieder an die militanten Islamisten fiel, als letzte Stadt des Landes. Zuvor hatten die Taliban bereits von 1996 bis 2001 in Afghanistan mit harter Hand geherrscht. Sie weigerten sich, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA den damaligen Al-Kaida-Führer Osama bin Laden auszuliefern. Die USA marschierten ein, vertrieben die Islamisten und stützten fortan die Regierung in Kabul, auch mit viel Hilfe aus Deutschland.
Bis 20 Jahre später, noch vor dem endgültigen Abzug der letzten amerikanischen Soldaten, mit der Flucht des gewählten Präsidenten Aschraf Ghani alles kollabierte. Über Jahre hatten die Taliban immer größer werdenden militärischen Druck ausgeübt. Westliche Hilfsgelder zum Aufbau nachhaltiger staatlicher Strukturen versickerten hingegen größtenteils in den Taschen korrupter Politiker. Unzählige Zivilisten und Sicherheitskräfte verloren im Lauf der Jahre ihr Leben.
Wer heute durch Kabul läuft, kann leicht erkennen, wie die Armut in den vergangenen beiden Jahren gestiegen ist. Auch, weil das Land mit Sanktionen belegt ist. Viel mehr Kinder als früher versuchen, auf der Straße hart gekochte Eier oder Kaugummis zu verkaufen. An viel mehr Ecken sitzen Bettler, erzählt Nadschib, der eigentlich anders heißt. Viele kleine Restaurants sind verschwunden.
Die Frauen, die unterwegs sind, sind konservativer gekleidet. Neu im Straßenbild sind Männer in weißen Kitteln, die aussehen wie Ärzte, aber keine sind: die Taliban-Offiziellen des «Ministeriums zur Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters». Sehen sie Männer, deren Hosen oder Ärmel zu kurz geraten sind oder die keinen Bart tragen, halten sie sie an. Sie bestrafen sie nicht - noch nicht, sagt Nadschib. Aber sie werden «beraten».
Wenn Safia Resai an die nun nicht mehr so neuen Herrscher denkt, fallen ihr als erstes ihre geplatzten Träume ein. Als die Islamisten die Macht übernahmen, studierte die heute 23-jährige an der Universität von Kabul Journalismus. Am liebsten wollte sie im Ausland ihren Abschluss machen und dann in den Beruf - um, wie sie sagt, «mir selbst, meiner Familie und meinem Land zu dienen».
Heute weiß die junge Frau nicht mehr, wie ihre Zukunft aussehen soll. «Ich kann nicht tragen, was ich will. Ich kann nicht studieren. Und das tut mir weh.» Ihre Landsleute seien zu gespalten, um das Land gemeinsam voranzubringen. Auch an die internationale Gemeinschaft richtet sie Vorwürfe. Die USA und ihre Verbündeten hätten Afghanistan verraten und den Taliban ausgeliefert. Ihr Leben vor ein paar Jahren beschreibt sie so: «Wir hatten keine Sicherheit, aber Hoffnung.» Heute gebe es Sicherheit, aber all ihre Hoffnung sei dahin.
Weil sie als Frau keine Universität mehr besuchen kann, macht sie nun zu Hause Online-Kurse. «Wenn die Schulen und Universitäten für uns verschlossen bleiben, machen wir aus jedem Haus eine Schule und Universität.» Auch an die Zeit unter der vom Westen gestützten Regierung hat Safia nicht nur gute Erinnerungen. Immer wieder habe es Explosionen gegeben, ihre besten Freunde habe sie dadurch verloren.
Nadschib sagt, vieles unter den neuen Machthabern sei weiter im Fluss. In den Provinzen Badachschan, Laghman oder Kandahar müssten Geschäfte zu den Gebetszeiten geschlossen werden, in Kabul noch nicht. Bei den groß gefeierten Hochzeiten sei erst Live-Musik verboten worden. Nun sei ein DJ nur im Frauenbereich erlaubt, aber viele trauten sich auch dies nicht mehr. «Auch das wird sicher bald verboten.» Das Tugend-Ministerium sei die wichtigste Behörde geworden. «Die sind in alles involviert.»
So wie wohl auch der Taliban-Geheimdienst GDI. Journalisten treffen heute bei Recherchen oft nur eine Mauer des Schweigens. Kritiker würden verfolgt, auch Familienmitglieder unter Druck gesetzt. Es heißt, jeder kritisiere die Taliban zuhause - aber nie auf der Straße. Im Fernsehen laufen heute Kochshows statt kritischer Debatten.
Der Arzt Mohammad Salim Safi aus der Provinz Nangahar freut sich darüber, dass Ärzte heute wieder Zugang zu vielen Patienten in abgelegenen Gebieten haben, was früher aufgrund der Kämpfe nicht möglich gewesen sei. Es gebe auch keine Drohungen mehr von Taliban-Kommandeuren oder der Terrormiliz Islamischer Staat. Zugleich aber litten nun viele unter Arbeitslosigkeit und Armut.
«Zehntausende von Menschen, die für die alte Regierung angestellt waren, haben ihre Arbeit verloren und brauchen Geld, um ihre Familien zu ernähren», beklagt Safi. Und spricht damit das beherrschende Thema an: Während sich die internationale Gemeinschaft vor allem auf Mädchenbildung fokussiert, dreht sich der Großteil der Sorgen bei Afghanen heute vor allem darum, wie sie Essen auf den Tisch bekommen.
Trotz der größtenteils desaströsen Lage erwartet der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig keinen baldigen Machtwechsel. «Die Taliban sitzen fest im Sattel», so Ruttig. Oppositionsgruppen, die während der ersten Herrschaft der Taliban noch breite Unterstützung in der Bevölkerung hatten, hätten sich durch Mitarbeit an der korrupten, vom Westen gestützten Regierung als unfähig erwiesen.
Die heutige Opposition schaffe es nicht, ethnische Spaltungen zu überwinden und könne nicht auf Unterstützung aus dem Ausland hoffen. Viele Afghanen hätten nach mehr als 40 Jahren Krieg schlicht kein Interesse mehr an weiteren Kämpfen. Trotzdem warnt Ruttig davor, Afghanistan fallen zu lassen. Man könne die Bevölkerung nicht für die Fehler der vorigen Regierung verantwortlich machen, sondern müsse den Druck auf die Taliban hochhalten - gerade in Bezug auf Mädchenbildung. Der Ausschluss der weiblichen Bevölkerung werde den Taliban auf lange Sicht wirtschaftlich auf die Füße fallen.