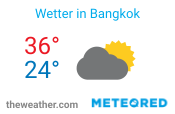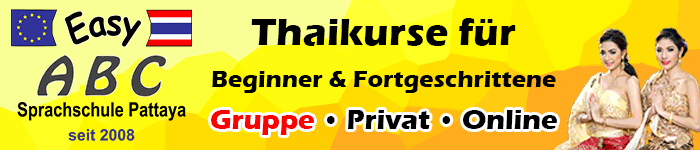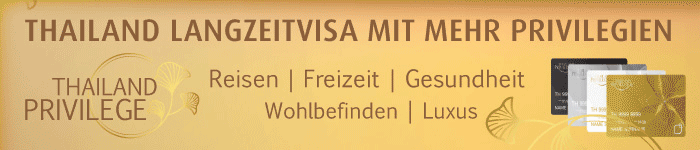TAPACHULA/WASHINGTON (dpa) - Ihr beschwerlicher, gefährlicher Weg in die USA endet jäh in Südmexiko: Tausende Afrikaner stecken dort seit Monaten fest. Grund ist die Migrationsvereinbarung der beiden Länder. Wie es damit weiter geht, soll jetzt in Washington besprochen werden.
«Wir wollen hier weg», skandieren einige Dutzend Afrikaner unter der sengenden Sonne Südmexikos. Sie tanzen und trommeln mit Plastikeimern und Plastikflaschen, die sie mit Sand gefüllt haben. Ihnen gegenüber stehen regungslos in einer langen Reihe Soldaten der Nationalgarde in Kampfausrüstung. Diese Szene spielt sich seit drei Wochen jeden Tag vor dem Migrantenlager «Siglo XXI» (21. Jahrhundert) in der Nähe der Grenze zu Guatemala ab.
Die Afrikaner stammen aus verschiedenen Ländern. Sie sind nach eigenen Angaben vor Krieg oder Verfolgung auf der Flucht und wollen in die USA. Ihre Odyssee begann mit einem Flug nach Ecuador - das südamerikanische Land verlangt kein Visum. Tausende Kilometer haben sie von dort auf dem Landweg zurückgelegt. In der südmexikanischen Stadt Tapachula ist nun erstmal Schluss. Dort stecken mehr als 3.000 Migranten aus Afrika, zum Teil seit Monaten, fest, wie sie sagen.
Zuerst kamen sie in das Lager, das sie als «Gefängnis» bezeichnen. Nach etwa zwei Wochen seien sie auf die Straße gesetzt worden. Manche von ihnen schlafen nun in Zelten vor dem Lager. Sie teilen sich ihr bisschen Geld, um sich Essen und Wasser zu kaufen. Den Soldaten werfen sie vor, sie zu schlagen. Mit ihrem Protest wollen sie erreichen, dass Mexiko sie endlich weiterziehen lässt.
Bis vor drei Monaten wäre das wohl kein so großes Problem gewesen. Doch damals, am 7. Juni, kam die mexikanische Regierung zu einer Vereinbarung mit ihrem nördlichen Nachbarn. US-Präsident Donald Trump hatte mit Strafzöllen auf alle mexikanischen Importe gedroht, wenn Mexiko nichts gegen die stark zugenommene Migration aus Mittelamerika über Mexiko in die USA unternehme. Die «Krise» an der Grenze ist ein Kernthema für Trump, mit dem er seine Anhänger mobilisiert.
Die mexikanische Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador verpflichtete sich, die Nationalgarde an den Grenzen mit den USA und Guatemala einzusetzen. Seitdem ist die Zahl der Migranten um mehr als die Hälfte gesunken: Nachdem US-Grenzpolizisten im Mai noch mehr als 144 000 Menschen beim illegalen Übertritt der Grenze mit Mexiko festgesetzt hatten, waren es im August nur noch rund 63 000.
Kritiker in Mexiko meinen, durch die Militarisierung seiner Grenzen opfere das Land schutzbedürftige Migranten für bessere Beziehungen zu den USA. Der Linkspopulist López Obrador, der seit Dezember regiert, hatte im Wahlkampf eine bessere Behandlung von Migranten versprochen.
Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard reist am Dienstag zu Gesprächen mit der US-Regierung nach Washington. Anlass ist der Ablauf einer 90-tägigen Frist, die in der Vereinbarung vorgesehen ist. Wenn die bisherigen Maßnahmen bis dahin nicht die erhoffte Wirkung gezeigt haben, sollen weitere beschlossen werden. López Obrador spricht von «guten Resultaten», aber sehen die USA das auch so?
Trump lobte die mexikanische Regierung zuletzt mehrfach öffentlich. Was diese an der Grenze tue, sei «großartig», ihre Hilfe «weitaus größer als irgendjemand für möglich gehalten hätte». Kein Vergleich zu den Schimpftiraden vor Monaten, als Trump den Mexikanern vorwarf, nichts gegen die illegale Migration zu tun und die USA auszunutzen.
Aus dem US-Außenministerium heißt es auf Anfrage etwas nüchterner, die mexikanische Regierung habe «lobenswerte Anstrengungen» unternommen, um die Grenze besser zu sichern. «Dennoch müssen wir weitere Fortschritte machen», sagt ein Sprecher. Es gebe noch viel Arbeit, die Verpflichtungen aus dem Abkommen zu erfüllen.
Eine mögliche weitere Maßnahme ist, dass Mexiko zum sicheren Drittstaat erklärt wird. Dann müssten alle Migranten, die über Mexiko in die USA wollen, in Mexiko Asyl beantragen. Das forderten die USA schon bei den Verhandlungen im Juni. Ende Juli unterschrieben sie ein Drittstaat-Abkommen mit Guatemala, das dort jedoch vor Gericht angefochten wird. Mexiko lehnt einen solchen Deal für sich ab.
Die Mehrheit der Migranten stammt aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, Honduras und El Salvador. Sie fliehen vor Armut und der Gewalt mächtiger Banden. Mexikanische Medien berichten, Mexiko habe in diesem Jahr schon mehr als 100 000 Mittelamerikaner abgeschoben - 63 Prozent mehr als 2018 im selben Zeitraum.
Die Afrikaner werden nicht in ihre Heimat abgeschoben, sondern aufgefordert, Mexiko Richtung Süden zu verlassen. Für 1500 US-Dollar bekomme man von den Migrationsbeamten eine Durchreisegenehmigung, mit der man zur US-Grenze komme, sagt ein Migrant, der aus Angst vor Repressalien seinen Namen nicht nennen will.
«Wer Geld hat, kommt problemlos an die nördliche Grenze. Wer keins hat, eben nicht», sagt der Aktivist Irineo Mujica, Leiter der Organisation Pueblo sin Fronteras (Volk ohne Grenzen), die sich für Migranten einsetzt. «Die Afrikaner bleiben in diesen Gefängnisstädten stecken, in denen es keine Arbeit gibt, wo sie auf der Straße schlafen müssen, wo sie krank werden und ihnen nicht geholfen wird.»
López Obrador hat über die Proteste der Afrikaner gesagt: «Sie werden zu nichts führen.» Die Migranten wollten Mexiko zwingen, ihnen Papiere zu geben, die ihnen die Einreise in die USA erlauben. «Das können wir nicht machen, das ist nicht unsere Aufgabe.»
Für den 17 Jahre alten Kongolesen Rabi sind die USA das «Gelobte Land» - man könne dort frei und gleichberechtigt leben. Er sagt, er sei mit seinem Vater und seiner Schwester im April in Ecuador aufgebrochen. Im undurchdringlichen Darién-Urwald an der Grenze zwischen Kolumbien und Panama, den Guerilleros und Banden unsicher machen, sei sein Vater bei einem Sturz gestorben.
Er habe das Ganze nicht auf sich genommen, um in Tapachula festzustecken, sagt Rabi. Mit Blick auf die wenige Meter entfernt stehenden Soldaten ergänzt er: «Sollen sie mich doch töten oder lebenslang ins Gefängnis stecken - das wäre besser für mich.»