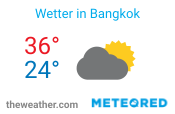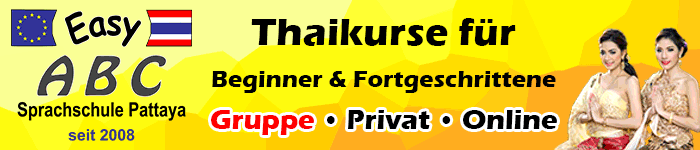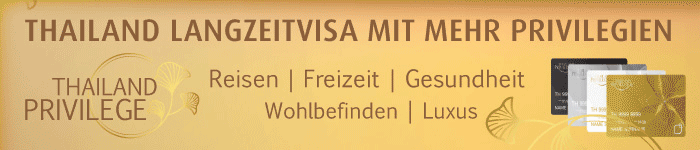RENK: Seit nahezu einem Jahr dauert der blutige Machtkampf im Sudan an. Mehr als neun Millionen Menschen sind auf der Flucht vor den Kämpfen, im Sudan und über die Grenzen hinweg. Etwa in Renk.
Claudia Godid hat sich auf einem Bettgestell niedergelassen und den grünen, zerschlissenen Schal tiefer ins Gesicht geschoben, um sich vor dem allgegenwärtigen Staub zu schützen. Müde blickt sie in Richtung der beiden Fahnenstangen, die gut 100 Meter entfernt die Grenze zwischen Südsudan und Sudan markieren. Sie ist aus der Ortschaft Rabak gekommen, ursprünglich hat sie in Khartum gelebt.
Alle wollten nur noch weg
«Es war schlimm, sehr sehr schlimm», sagt die Frau mit dem von den Strapazen der Flucht gezeichneten Gesicht über den Beginn des blutigen Konflikts im Sudan vor einem Jahr. Furchen haben sich in ihr Gesicht gegraben, die Augen wirken wie leer. «Es war nicht mehr sicher - die Luftangriffe, die Schießereien. Viele Frauen wurden vergewaltigt.»
In Rabak hatte sie sich lange sicher gefühlt - doch dann waren auch dort aus immer kürzerer Entfernung Schüsse zu hören, ließen sich Bewaffnete blicken. «Der ganze Ort hat sich auf den Weg gemacht, um zu fliehen», erzählt sie. «Ich hätte nicht bleiben können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Alle Geschäfte hatten geschlossen. Alle wollten nur noch weg.»
Politik der offenen Tür am Grenzübergang
Auf der staubigen Sandpiste, die vom Grenzübergang Joda die Straße nach Khartum markiert, herrscht reges Treiben. Immer wieder schleppen sich neue Flüchtlinge über die Grenze, meist Frauen mit Kindern, aber auch junge Männer, die vor den Kämpfen im Sudan fliehen. Wer es sich leisten kann, hat einen Eselskarren gemietet, um mit dem Gepäck die letzte Wegstrecke etwas bequemer zurückzulegen.
Für die Menschen aus dem Dorf Joda bedeuten die Neuankömmlinge eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit, und auch die Geldwechsler, die gleich hinter der Grenze im Schatten eines Dornbuschs mit ausgebreiteten Geldbündeln sudanesischer und südsudanesischer Pfund auf Kunden warten, gehören zu den Krisengewinnlern. «Für unser Geschäft ist der Konflikt gut», sagt einer von ihnen schulterzuckend.
Die Grenzsoldaten haben sich bei mehr als 40 Grad Hitze in eine Strohhütte zurückgezogen. Kontrolliert wird hier seit Monaten nicht mehr, obwohl Joda der Grenzposten ist, über den die weitaus meisten der mehr als 600.000 Menschen ins Land kommen, die bisher aus dem Sudan in das südliche Nachbarland geflohen sind. «Wir haben eine Politik der offenen Tür», sagt Albino Atol Atak Mayom, der Minister für Humanitäres in der Landeshauptstadt Juba. «Diese Menschen fliehen vor dem Krieg. Sie haben ein Recht darauf, geschützt zu werden.»
Größte Flüchtlingsbewegung weltweit
Seit einem Jahr dauert im Sudan der blutige Machtkampf der Generäle Abdel Fattah al-Burhan und Mohamed Hamdan Daglo an. Einst haben sie sich gemeinsam an die Macht geputscht, nun will jeder alleine über die Zukunft des Landes bestimmen. Die Leidtragenden sind Menschen wie Claudia und die etwa 1500 Flüchtlinge, die täglich in Joda die Grenze zum Südsudan überqueren, die hunderttausenden, die innerhalb des Sudans immer wieder nach einem sicheren Zufluchtsort suchen müssen.
Mehr als neun Millionen Menschen sind nach UN-Angaben mittlerweile vor dem Konflikt geflohen. Es ist die größte Flüchtlingskrise der Welt - und doch macht sie nur selten Schlagzeilen, weil sie im Schatten der Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine steht.
Grenzstadt wird immer voller
Renk, die kleine Stadt im Grenzgebiet, ist seit dem vergangenen April vom Konflikt im Nachbarland und der Ankunft der Flüchtlinge geprägt. Eigentlich ist der Ort nur als Durchreisestation gedacht. Es gibt zwei Transitzentren, in denen die Neuankömmlinge eigentlich nur zwei Wochen bleiben sollen, um dann weiterzureisen - entweder in das Flüchtlingslager Maban, oder in andere Orte im Südsudan. Nach einer Flut im vergangenen Jahr sind die Wege aber unpassierbar.
Die schiere Zahl der Menschen hat die Planung durcheinander gebracht. In dem Transitlager, das für 3000 Menschen angelegt ist, leben mittlerweile 15.000 Flüchtlinge. Längst gibt es nicht mehr genug Platz in den Baracken. Viele campieren irgendwo im Lager, entlang der Zäune, in provisorischen Verschlägen aus Stöcken und Decken.
Flüchtlinge berichten von Attacken und Raub
Unter ihnen ist die 47 Jahre alte Aydel Naika. Sie hat sich mit ihren neun Kindern in Sicherheit gebracht. Für sie schließt sich ein Kreis: Im Jahr 2013 floh die gebürtige Südsudanesin vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in den Sudan. Nun hat der dortige Konflikt sie wieder in die Flucht in den Süden getrieben. «Als die Bomben fielen, hatten wir keine Wahl», sagt sie. «Sie treffen alle, ob Zivilisten oder Milizen.»
Als Südsudanesin sei sie unterwegs Angriffen ausgesetzt gewesen: «Sie haben uns geschlagen, sie haben uns alle unsere Wertsachen abgenommen», sagt sie über die jungen Männer, die unterwegs Jagd auf Flüchtlinge machten. Jetzt hofft sie, bei Angehörigen in Malakal ihr Leben und das ihrer Kinder wieder aufzubauen.
Hoffnung auf Aufnahme im Ausland
In einer Baracke im Transitzentrum für Geflüchtete in Renk, einem Städtchen unweit der Grenze, schaukelt Fatma Mohammed ihren Jüngsten auf dem Arm. Sie hat sich nach Beginn des Konflikts von Khartum nach Wad Madani im sudanesischen Bundesstaat Jazira durchgeschlagen, doch im Dezember begannen mit einem Angriff von Daglos Miliz RSF die Kämpfe auch dort.
Die vierfache Mutter ist Sudanesin, ihr Mann war ein Regierungsangestellter. «Ich weiß nicht, ob er noch lebt, ich fürchte das Schlimmste», sagt sie leise. Ein Onkel hat sie auf der Flucht begleitet. Nun ruht er auf einer Strohmatte in der Baracke aus, die sie sich mit fünf anderen Familien teilen. Ihre Zukunft ist noch ungewisser als die der Südsudanesen, die von der Regierung in Juba als Rückkehrer eingestuft und in ihre ursprünglichen Heimatregionen umgesiedelt werden. Doch für die meisten ist es eine fremde Heimat, in der die Kinder noch nie waren.
Eine Zukunft im Flüchtlingslager, womöglich noch jahrelang, will sich Fatma Mohammed nicht vorstellen. «Vielleicht schaffe ich es ja ins Ausland», hofft sie. «Hauptsache, meine Kinder können wieder in die Schule. Sie haben doch schon ein ganzes Jahr verloren.» Sie hofft, dass sie nach Ägypten ausreisen kann, auch, weil dort ebenfalls Arabisch gesprochen wird - und der Sudan ist nicht weit, für den Tag, an dem eine sichere Rückkehr wieder möglich ist.
Ein Stück Normalität für die Kinder schaffen
Hilfsorganisationen versuchen, wenigstens für die Kinder ein kleines bisschen Alltagsstruktur im Chaos der Flucht zu schaffen. In den «sicheren Orten» für Kinder kümmern sich Pädagogen um sie, singen oder malen mit den Kleinen, die für eine oder zwei Stunden unbekümmerte Kinder sein können. Einige Kinder haben sich aus Abfall Spielzeug gebastelt oder spielen am späten Nachmittag, wenn die Hitze nachlässt, zwischen den Baracken Fußball. Der sieben Jahre alte Salah lässt den Drachen steigen, den sein Vater aus Plastiktüten und Stöcken gebaut hat, um das Kind über den Verlust seiner Spielsachen und das Heimweh zu trösten.
Trauma und Gewalterfahrungen
Viele Kinder sind traumatisiert, brauchen eigentlich psychosoziale Betreuung. Ein Transitzentrum sei darauf eigentlich nicht ausgerichtet, räumt Makuach Peter Deng von der Kinderrechtsorganisation «Save the children» ein. «Wir versuchen aber, Informationen über Kinder weiterzuleiten, die möglichst bald besondere Unterstützung brauchen.»
Menschenrechtsorganisationen werfen den Konfliktparteien im Sudan schwere Menschenrechtsverletzungen und Gewalt gegen Zivilisten vor: willkürliche Erschießungen, Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt auch gegen Kinder. Vor allem gegen die RSF werden schwere Vorwürfe erhoben.
Immer wieder Neuankömmlinge
Jeden Nachmittag treffen im Transitlager neue Lastwagen von der Grenze ein. Lagerbewohner scharen sich um die Fahrzeuge - vielleicht sind ja bekannte Gesichter unter den Neuankömmlingen, vielleicht gibt es Informationen über Angehörige und ihr Schicksal.
Auf der Ladefläche ballen sich Flüchtlinge und ihre Habe, nur für Alte, Kranke und Frauen mit Babys gibt es eine etwas bequemere Busfahrt ins Transitlager. Doch auch für sie ist die dreistündige Fahrt von Joda über die Piste mit ihren vielen Schlaglöchern alles andere als angenehm.
Beschwerliche Weiterreise auf dem Weißen Nil
Qualvolle Enge herrscht auch auf den Booten, mit denen diejenigen, die das Transitlager verlassen können, auf dem Weißen Nil in die Stadt Malakal gebracht werden. Mehr als 500 Menschen sitzen in den Booten auf engstem Raum zusammen, auf den Bündeln mit ihrer Habe. Geld für Trinkwasser hat kaum jemand, viele füllen vor dem Aufbruch Wasser aus dem Fluss in Flaschen und Behälter.
Eine Toilette gibt es ebenso wenig wie eine Waschgelegenheit. Kinder liegen schon vor dem Aufbruch der Boote apathisch in den Armen ihrer Mütter, andere weinen. Platz, sich ein wenig zu bewegen oder auch nur die Beine zu strecken, gibt es nicht. Nur der Gedanke an die tägliche Pause am Ufer dürfte den Flüchtlingen die dreitägige Bootsreise leichter machen.
Warten auf Nachrichten von Angehörigen
Doch es gibt auch diejenigen, die trotz der zunehmend prekären Verhältnisse im Transitlager von Renk lieber nahe der Grenze ausharren, weil sie weiterhin auf Nachrichten über vermisste Angehörige im Sudan warten.
Die 29 Jahre alte Katmallah Mahdi und ihre vier Freundinnen etwa haben sich zu einer ebenso verzweifelten wie entschlossenen Schicksalsgemeinschaft zusammengeschlossen. «Wir haben seit Monaten nichts von unseren Männern gehört», sagt Katmallah, die Wortführerin der jungen Frauen, die sich mit ihren Kindern eine zeltartige Unterkunft teilen. «Das Internet funktioniert nicht mehr im Sudan, das Mobilnetz auch nicht. Wir wissen nicht, wer lebt und wer getötet wurde.»
Im Dezember waren sie vor den Kämpfen in Wad Madani in den Südsudan geflüchtet - damals hatten sie Lebensmittel für jene zwei Wochen erhalten, die sie eigentlich im Transitlager bleiben sollten. «Wir haben Kleider verkauft, um Lebensmittel kaufen zu können», berichtet Katmallah. Eine ihrer Freundinnen stampft Sorghum, nachdem sie die Hirsekörner zuvor sorgfältig aus einer Tasse abgemessen hat. Es muss für alle reichen, einschließlich der draußen spielenden Kinder. Doch richtig satt dürfte keiner werden.
«Wir unterstützen uns gegenseitig», sagt die junge Frau. Trost und Zuspruch, Hilfe bei der Betreuung der Kinder oder wenn sich eine erschöpft oder traurig fühle. «Unsere Freundschaft gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um das alles durchzustehen.» Was die Zukunft bringt und wann der Konflikt in ihrer Heimat endet - das können sich die fünf Frauen derzeit kaum vorstellen. «Es ist schwer, zu hoffen. Wir können nur beten, dass es besser wird.»