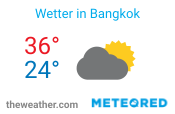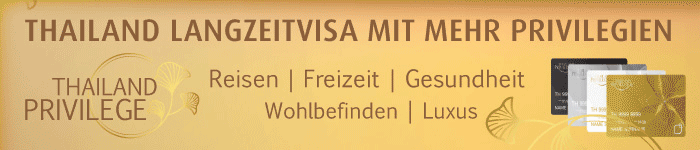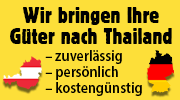KABUL/BERLIN (dpa) - Horst Seehofer war zufrieden: «Ausgerechnet» an seinem 69. Geburtstag wurden 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Die Äußerung sorgte für Furore, auch weil einer der Betroffenen sich dann erhängte. Ein Extremfall - aber Schwierigkeiten haben viele Rückkehrer.
Horst Seehofer sei «ein erbärmlicher Zyniker und dem Amt charakterlich nicht gewachsen», schäumte Juso-Chef Kevin Kühnert. Vor einem Jahr hatte der Innenminister von der CSU mit Wohlgefallen auf einen gut besetzten Abschiebeflug nach Afghanistan hingewiesen. «Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war», sagte Seehofer am 10. Juli 2018.
Einen Tag später wurde bekannt, dass sich einer der Männer nach der Ankunft in Kabul erhängte. Seehofer reagierte betroffen auf die Nachricht und dünnhäutig auf die Empörung über seine Worte. Die Aufregung um die Formulierungen des Ministers hat sich längst gelegt - doch was wurde aus den Betroffenen? Wie finden sich Abgeschobene in Afghanistan zurecht? Und sind unter Seehofers Ägide wirklich mehr Menschen dorthin abgeschoben worden als vorher?
Sardar Dschafari steht im Garten eines Hauses in Westkabul und füllt langsam Wasser in einen orangefarbenen Plastikbehälter. Ein grün-gelber Vogel fliegt knapp an seinem Gesicht vorbei und lässt sich in einem der Dutzenden Tontöpfe in dem Vogelverschlag nieder. Rund um ihn piepsen und singen rund 40 Vögel - weiße, grüne, blaue, orange. Er lächelt. Der 20-Jährige lächelt eigentlich immer.
Dabei möchte man denken, dass ihm das Lächeln vergangen ist. Dschafari wurde im Januar aus München nach Kabul abgeschoben. Er sprach Deutsch, war gut integriert, wie er berichtet, hatte keine Probleme mit der Polizei und einen Ausbildungsvertrag als Bäcker in der Tasche.
Den Tag seiner Abschiebung, sagt Dschafari, werde er nie vergessen. Am Vormittag war er noch in der Schule, nur Stunden später legten ihm Polizisten Hand- und Fußfesseln an. «Das ist doch unmenschlich», sagte er zu ihnen. «Ich bin doch kein Schaf». Wieder wenige Stunden später stieg er in Kabul aus dem Flieger, einer Stadt, die er mehr als vier Jahre nicht gesehen hatte - und in die er nie mehr zurückkehren wollte.
Die ersten zwei Wochen lebte er erst in einer Unterkunft, die damals noch jedem Abgeschobenen von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) angeboten worden war. Danach mietete er ein Zimmer. Irgendwann riefen Freunde aus Deutschland an und sagten, er könne in Westkabul bei einem Zivilrechtsaktivisten leben, der immer wieder Abgeschobene aus Deutschland aufnehme. Seither lebt er bei dem alten Mann, der mit seinem riesigen Bart aussieht wie Karl Marx. Und jeden Morgen um sechs Uhr führt Dschafaris erster Weg zu den Vögeln.
Sein zweiter führt ihn in den Deutschkurs, den er täglich um acht Uhr besucht. Er will die Sprache nicht verlernen. Was er aber darüber hinaus lernen oder arbeiten möchte, das weiß er nicht. In Kabul selbst gebe es viele Arbeitslose. Es sei schwierig, alles sei schwierig, irgendwie. «Ich habe viel verloren.» Alles wieder von vorne aufzubauen, sei hart.
Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten in Deutschland, besonders Flüchtlingsorganisationen, Grüne und Linke üben Kritik. Politiker winden sich, wenn es darum geht, Menschen in ein Land zurückzubringen, in dem täglich Zivilisten sterben und das regelmäßig von Terroranschlägen heimgesucht wird. Es gebe starke regionale Unterschiede bei der Sicherheitslage, sagt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. «Die individuelle Bedrohungslage ist unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten und unter Einbeziehung sämtlicher individueller Aspekte des Einzelfalls zu beurteilen.»
Das Ergebnis ist ein Mittelweg: Die meisten SPD-geführten Bundesländer und Schleswig-Holstein schieben nur Straftäter, Menschen, die falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben, und sogenannte Gefährder, denen die Behörden schlimmste Taten bis hin zum Terroranschlag zutrauen, nach Afghanistan ab. Die Unions-geführten Länder beschränken sich nicht auf diese Gruppen.
Klar ist: Der Flug vom 3. auf den 4. Juli 2018, den Seehofer wegen der zahlreichen Passagiere als besonderen Erfolg wertete, war ein Ausreißer. Die vereinbarte Obergrenze liegt laut afghanischen Behörden bei 50 Passagieren pro Flug. Zwischen 11 und 46 Ausreisepflichtige waren bei den anderen Flügen, die es seither gegeben hat, an Bord, alle von ihnen laut Bundesinnenministerium Männer und volljährig. Dass der Juli-Flug so gut besetzt war, liegt laut Ministerium auch daran, dass erstmals seit längerer Zeit nicht mehr ausschließlich Straftäter, Identitätstäuscher oder Gefährder abgeschoben wurden. Wie viele der 297 Passagiere auf den 11 Afghanistan-Flügen, die nach dem Juli-Flug stattfanden, tatsächlich in diese drei Kategorien fallen, ist unklar - laut Innenministerium müssen die Länder dazu keine Zahlen vorlegen.
Nachvollziehen lässt sich, dass sich die Zahl der Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben wurden, mehr als verdoppelt hat gegenüber dem Vergleichszeitraum. Allerdings wurden im Sommer 2017 die Abschiebungen nach dem schweren Anschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul vier Monate lang ausgesetzt.
Geändert hat sich kürzlich auch, wie Abgeschobene nach ihrer Ankunft unterstützt werden. Wurde früher jenen, die keine Unterkunft hatten oder nicht sofort in die Provinzen reisten, von der IOM eine temporäre Unterkunft organisiert, erhalten seit April alle rund 150 Euro bar und Informationen, wo sie übernachten können. Weiter ist ein IOM-Arzt am Flughafen, genauso wie psychosoziale Berater. Später können sie sich laut Bundesinnenministerium weiter an die Organisation wenden, die Unterstützung und Beratung bei Jobsuche, Ausbildungsfragen oder Gesundheitsversorgung anbietet.
Inge Missmahl sitzt im psychosozialen Zentrum im Herzen Kabuls. Es sind Berater der von ihr gegründeten Organisation Ipso, die sich von hier aus zu jedem Abschiebeflug aufmachen. Sie führen noch am Flughafen Erstgespräche durch. Wer möchte, kann sich weiter an die Berater wenden.
Gut ein Drittel würde das auch tun, sagt Missmahl. Eines sei praktisch allen Abgeschobenen nach ihrer Rückkehr gemein: Die Scham, versagt zu haben. Sie berichteten zudem von Angst, nicht wieder in ihre Familie und Gemeinde aufgenommen zu werden.
Abdul Ghafur, der Direktor der afghanischen Flüchtlings-NGO Amaso, verfolgt seit langem das Schicksal aus Deutschland Abgeschobener. «Die meisten können hier nicht mehr überleben», sagt er. Der Großteil jener, die er beobachtete, habe das Land wieder verlassen - wer dort Familie habe, gehe in den Iran. Andere hätten sich in die Türkei durchgeschlagen, auch bis nach Griechenland. Den Abgeschobenen fehle das in Afghanistan wichtige soziale Netzwerk, nachdem sie über viele Jahre im Ausland waren. Das mache sich schon bei den einfachsten Dingen wie der Suche nach einer Unterkunft bemerkbar. Ohne männlichen Bürgen wird in Kabul kein Zimmer vermietet. Auch Jobs werden zumeist an Verwandte oder Freunde vergeben. Die Abgeschobenen überfordere aber auch die Gewalt im Land, sagt Ghafur. Manche würden ihre Zimmer aus Angst nicht verlassen.
Dschawad (Name geändert, Anm.) wurde mit dem berüchtigten Flug im Juli vor einem Jahr abgeschoben. Er war nach der Ankunft in demselben Hotel untergebracht, wie der junge Mann, der Suizid beging. Auch Dschawad ist nicht mehr in Kabul, er lebt mittlerweile im Iran. «In Kabul konnte ich nicht einen Tag zur Ruhe kommen, wie könnte ich dort leben?», sagt er in einer Sprachnachricht über WhatsApp. Die Menschen seien aggressiv, alle ständig angespannt.
Die Taliban hätten im Vorjahr in seinem Heimatdorf in einer südlichen Provinz Angriffe verübt und Häuser angezündet, sagt er. «Danach - was wäre mir noch geblieben?» Auf die Frage, wie sein Leben denn nun im Iran aussehe, das selbst unter einer massiven Wirtschaftskrise leidet und aus dem immer wieder Berichte über massive Diskriminierung von Afghanen kommen, antwortet er nicht mehr.
Dschafari in Westkabul schließt den Vogelverschlag wieder ab. Ja, er träume noch immer davon, eines Tages nach Deutschland zurückkehren zu können. Flucht sei aber keine Option, er könne die Toten am Weg bis heute nicht vergessen. Doch eins geht ihm immer wieder durch den Kopf: «Mein Chef hat gesagt, mein Platz ist immer noch frei.»