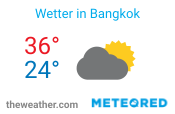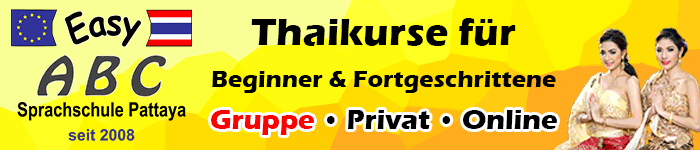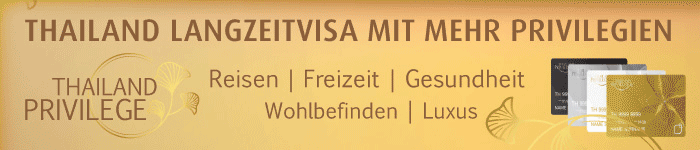«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zum Besuch von Abbas in Berlin
(.) An Scholz' Haltung besteht kein Zweifel.
Der Auftritt in Berlin zeigt aber auch ein weiteres Mal, dass die deutsche Sicht auf den Holocaust nicht überall auf der Welt geteilt wird. Das hat unterschiedlichste Gründe, die von einem Hass auf Juden bis zu einer weiten Form der Meinungsfreiheit reichen. Deutschland wiederum hat gute Gründe, für seine Position zu streiten. Die schwierige Staatskunst besteht darin, die eigene Haltung deutlich zu machen, ohne schulmeisterlich auf andere zu wirken. Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen hat erst einmal gar nichts getan - er hat auf Abbas nicht unmittelbar geantwortet. Unabhängig davon, inwiefern es sich hier um ein kommunikatives Versehen handelt: Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz wie ein begossener Pudel dasteht, anstatt Farbe zu bekennen. (.).
«Stuttgarter Zeitung» zum Holocaust-Eklat
So ist nun mitten in Berlin, wo einst die Vernichtung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden geplant und angeordnet wurde, vom höchsten Regierungsrepräsentanten eine Relativierung des Holocausts vorübergehend unwidersprochen geblieben.
In Scholz' Position ein schwerer politischer Fehler. Der politische Schaden ist da.
«Frankfurter Rundschau» zu Holocaust-Vergleich/Mahmud Abbas
Ein Eklat mit Ansage, denn Abbas wusste mit Sicherheit genau, was er hierzulande damit auslöst.
Es war ihm egal oder Recht. Dann aber müssen sich die Palästinenserinnen und Palästinenser fragen, ob der greise Präsident ihre Sache noch vertritt. Denn die Nahostdebatte krankt ohnehin an einem Schlagwortüberbietungswettbewerb. Die legitime Kritik an israelischen Siedlungsprojekten geht dabei unter. Abbas wäre auch mit dieser Kritik in Deutschland auf offene Ohren gestoßen. Das mag alles nicht genug sein. Der Frust über den Konflikt sitzt bei den Palästinenser:innen tief, über die wohlfeilen Politikerreden, über die Zwei-Staaten-Lösung, während längst Fakten geschaffen worden sind, die ein Zusammenleben immer schwieriger gestalten. All das hätte viel Gesprächsbedarf ergeben. Stattdessen debattieren wir, ob der Kanzler zu spät getwittert hat.
«Münchner Merkur» zu Olaf Scholz
Der Holocaust-Skandal reiht sich für Olaf Scholz ein in eine Serie von Pannen, Affären und Glücklosigkeiten.
Für ihn selbst und für das von ihm regierte Land wird das langsam zum Problem. Gerade ist der Ampelregierung die Gasumlage in Brüssel um die Ohren geflogen. Statt kraftvoll zu führen, dem Land den Weg aus der größten Krise der Nachkriegszeit zu weisen, kämpft Scholz mit seiner eigenen Krise, holt ihn die Cum-Ex-Steuerabzockaffäre ein. Der Kanzler kommt nicht in Form in einem Moment, in dem das Land einen Kanzler in Bestform bräuchte, schon um die Fliehkräfte in seiner sehr heterogenen Dreierkoalition zu bändigen. Atom, Steuerentlastung, Tempolimit: Die Ampel tut sich schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die von der Energiepreisexplosion geplagten Bürger haben genügend eigene Sorgen. Eine Regierung, die sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, ist das Letzte, was das Land in diesen Kriegszeiten braucht.
«Rzeczpospolita»: Verantwortung für das Fischsterben wird nie geklärt
WARSCHAU: Zum Fischsterben in der Oder schreibt die polnische Tageszeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:
«Die ersten 17 Tage nach den ersten Meldungen über die Umweltkatastrophe schwieg die Propaganda-Bestie, erschrocken über das Ausmaß des Problems. Dann begann das, was seit vielen Jahren eine Spezialität der polnischen Politik ist: Anschuldigungen und das Lenken der öffentlichen Diskussion in den Bereich des Absurden. Gab es Quecksilber oder nicht? Bis heute wissen wir nicht, wem wir glauben sollen und was die Fakten sind. Bekannt ist, dass bis Dienstag mehr als 80 Tonnen toter Fisch aus der Oder gefischt wurden, und es werden noch mehr. Experten sagen es deutlich: Die Oder ist tot, und das wird sie auch in den nächsten Jahren bleiben.
Es ist nicht klar, inwieweit die staatlichen Stellen dafür verantwortlich sind. Und die Behörden werden alles tun, um sicherzustellen, dass diese Verantwortung niemals genau geklärt wird. Ist zum Beispiel der niedrige Wasserstand das Ergebnis der Regulierungspolitik? Ist die Betonierung des Ufers dafür verantwortlich, dass sich die Oder nicht mehr selbst reinigen kann und es keine Verstecke für Fische mehr gibt? Das sind nur einige der Fragen, doch die wichtigste ist noch nicht beantwortet: Hat jemand das Gift in den Fluss gekippt, und wer war dieser Jemand?»
«Lidove noviny»: Russland hat Verbündeten wenig anzubieten
PRAG: Der russische Präsident Wladimir Putin hat jüngst einen Ausbau der militärischen Kooperation mit den Verbündeten seines Landes angekündigt. Dazu schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:
«Russland braucht keine Verbündeten, sondern Vasallen. Seine Verbündeten sind keine Verbündeten im eigentlichen Sinne, sondern ein Gemisch verschiedener Mächte (China, Indien, Indonesien, Brasilien, Südafrika) und mehr oder weniger bizarrer Staaten (Belarus, Syrien, Venezuela, Nordkorea). Was das Angebot der Lieferung russischer Waffen an Partnerländer angeht, so rühmt sich Russland zwar gerne mit seinen Produkten. Doch die modernen Waffen sind noch nicht fertig - und die erprobten Waffen sind nicht modern. Die Kalaschnikow ist zwar weltberühmt, aber braucht China solche Sturmgewehre noch? Sicherlich darf man Russland nicht unterschätzen, aber mehr und mehr verhält es sich so, also ob es seiner eigenen Propaganda glauben würde.»
«Washington Post»: USA brauchen mehr Liz Cheneys
WASHINGTON: Die US-Zeitung «Washington Post» schreibt zur Niederlage der wichtigsten innerparteilichen Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump, Liz Cheney, bei Vorwahlen im Bundesstaat Wyoming:
«Während viele Republikaner (einschließlich ihrer Kontrahentin) sagen, die Präsidentenwahl 2020 sei manipuliert worden, weigert sich Cheney, sich an der Wahlleugnung zu beteiligen. Während fast alle ihre Kollegen im Repräsentantenhaus sich weigerten, sich den Bemühungen der Demokraten anzuschließen, den Aufstand vom 6. Januar zu untersuchen, spielte Cheney eine zentrale Rolle in dem Sonderausschuss, der die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen soll. Ihre Teilnahme verlieh dem Unterfangen parteiübergreifende Legitimität.
Sie hat verloren, weil sie sich weigerte, sich Trump zu beugen - oder zumindest zu seiner Kampagne zur Untergrabung der US-Demokratie zu schweigen. Der Unterschied zwischen ihr und der republikanischen Führung im Repräsentantenhaus, von der sie verdrängt wurde, besteht darin, dass sie erkannt hat, dass Ideologie und Parteiloyalität keine Rolle spielen sollten, wenn es um eine grundlegende Bedrohung der Demokratie geht. Das Land braucht, unabhängig von ihren Positionen zu Steuererhöhungen, Deregulierung oder Freihandel, mehr Liz Cheneys in der Regierung. Jetzt wird es eine weniger haben.»
«Irish Times»: Rutos Wahlsieg in Kenia weckt Hoffnung und Sorge
DUBLIN: Die irische Tageszeitung «Irish Times» kommentiert am Mittwoch den knappen Sieg von William Ruto bei der Präsidentschaftswahl in Kenia:
«Er stellte Klassengegensätze in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs, betonte seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen und präsentierte sich als Stimme der Armen in einem Land, das nach seinen Worten von Ungleichheit und Korruption zerrissen ist. Angesichts der Tatsache, dass die Armen bereits schwer unter den Auswirkungen von Corona, steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen und einer verheerenden Dürre im Norden des Landes zu leiden haben, war dies eine Botschaft, die großen Anklang fand.
Ruto steht in der Tat für Veränderung. Ob es jedoch der Wandel ist, den Kenia braucht, ist eine andere Frage. Er wurde vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, weil er angeblich in die Gewalt nach den Wahlen 2007 verwickelt war (die Anklage wurde fallengelassen). Und gegen eine Reihe seiner Verbündeten wurde im Zusammenhang mit anderen Verbrechen ermittelt. Sein Wirtschaftsliberalismus, gepaart mit der Rhetorik eines starken Mannes, erinnert an populistische Führer in anderen Ländern. Wenn die Gerichte das Wahlergebnis bestätigen, wird Kenia einen Präsidenten haben, dessen Aufstieg sowohl Hoffnung als auch Sorge hervorruft.»
«Independent»: Großbritannien muss Wettbewerbsfähigkeit stärken
LONDON: Die britische Tageszeitung «The Independent» kommentiert am Mittwoch die wirtschaftliche Lage Großbritanniens:
«Die Aussichten für die nächste Regierung sind entmutigend. Abgesehen vom derzeitigen Inflationsdruck wird weithin befürchtet, dass Großbritannien nächstes Jahr eine Rezession droht. Es gibt jedoch einige Stärken, auf die sie aufbauen kann: Der Arbeitsmarkt scheint solide zu sein, und das Haushaltsdefizit ist schneller als erwartet zurückgegangen. Letztendlich ist jedoch ein detailliertes und solides Programm erforderlich, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft zu verbessern.
Die nächste Regierung wird sich daran messen lassen müssen, wie gut sie auf die aktuelle Herausforderung der Krise der Lebenshaltungskosten reagiert. Aber auch daran, ob es ihr gelingt, die Bewältigung der längerfristigen Probleme in Angriff zu nehmen. Der Druck auf den Lebensstandard sollte ein Weckruf sein, nicht nur für die Politiker, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Wir müssen mehr tun, wenn wir das Wohlergehen aller Bürger in den kommenden Jahren sicherstellen wollen.»
«NZZ»: Wahltheater in Kenia ist Gift für Demokratie
ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Mittwoch die Präsidentschaftswahl in Kenia:
«Es sind bemerkenswerte Worte, mit denen sich William Ruto am Montag an sein Volk richtete. «Es gibt keine Verlierer in dieser Wahl», sagte der neue Präsident Kenias kurz nach Bekanntgabe der Resultate. «Das kenianische Volk hat gewonnen.» Für den Zweitplatzierten Raila Odinga, der nunmehr zum fünften Mal eine Präsidentschaftswahl verloren hat, dürfte das wie Hohn klingen. Bemerkenswert sind die Worte aber vor allem deshalb, weil es nach den Ereignissen der letzten Wochen in Kenia einen noch viel bedeutsameren Verlierer gibt: die Demokratie.
Bereits im Wahlkampf hatte sich abgezeichnet, dass der Glaube an die Erneuerungskraft des politischen Systems in Kenia gering ist. Gerade junge Kenianerinnen und Kenianer zeigten weniger Interesse an diesen Wahlen als in früheren Jahren. Das liegt nicht an einem generellen Politikverdruss. Es liegt an den Kandidaten selbst. Ruto und Odinga sind seit Jahrzehnten Teil der politischen Elite des Landes. Viele in Kenia haben sich von dieser Wahl einen wirklichen Wandel erhofft. Doch der stand nicht auf dem Wahlzettel. Ruto und Odinga stehen in vielerlei Hinsicht gar für das genaue Gegenteil davon: für einen Erhalt des Status quo und für eine politische Elite, die sich in Endlosschleife reproduziert.»