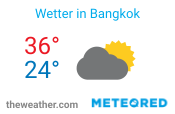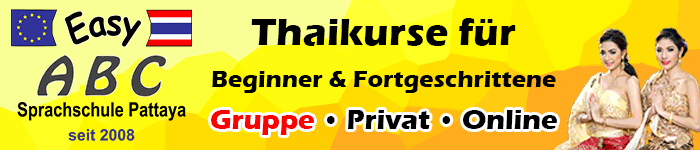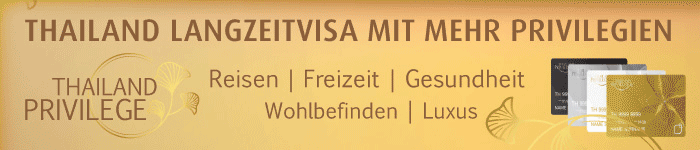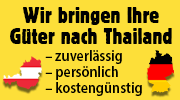LA PALMA: Der Vulkanausbruch auf La Palma war der längste in der bekannten Geschichte der Kanareninsel. Er richtete immense Schäden an, die noch lange nicht behoben sind. Die Menschen erzählen von Optimismus und Hilfsbereitschaft, aber auch von Behördenwirrwarr und Abzocke.
«Da rechts war der Tennisplatz», ruft die Deutsche Kathrin Heinsch aufgeregt. Zu sehen ist vom Auto aus nur eine schwarze Mondlandschaft aus erkalteter Lava. Mit schwerem Baugerät ist erst vor kurzem eine Behelfspiste über das rund zwei Kilometer breite Lavafeld im Aridane-Tal im Westen der Kanareninsel La Palma geschlagen worden. Mit dem Ausbruch des Vulkans Tajogaite am Nachmittag des 19. September vergangenen Jahres war es mit der Idylle aus kleinen Landhäusern, Bananenplantagen und Weinbergen im milden Klima des Atlantiks vorbei. Die Lava zermalmte und begrub alles unter sich.
Mindestens 7000 Menschen mussten wegen des Vulkanausbruchs evakuiert werden, 3000 konnten nie zurückkehren, weil ihre Häuser zerstört wurden. So erging es auch der aus Berlin stammenden Heinsch, als sie zwei Tage nach dem Beginn des Vulkanausbruchs noch mal ganz kurz in das von ihr in dem Ort Todoque gemietete Haus durfte. Feuerwehrleute drängten zur Eile, und sie floh mit drei linken Schuhen und einer gerade blühende Kurkuma-Pflanze. Der Rest ihres Hausstands verbrannte.
Insgesamt 1200 Hektar wurden von der Lava begraben, davon 230 Hektar Bananenplantagen, dem wichtigsten Erzeugnis der Insel. Rund 19.500 der gut 80.000 Inselbewohner leben direkt oder indirekt vom Bananensektor, der etwa 30 Prozent des Inseleinkommens sichert, sagt Domingo Martin von der Vereinigung der Bananenkooperativen, Cupalma. Viele der Evakuierten leben bis heute bei Verwandten, Freunden oder in Hotels, die der Staat bezahlt.
Die Behörden schätzen die Schäden und wirtschaftlichen Verluste auf insgesamt etwa 1,2 Milliarden Euro. An staatlichen Hilfen und Versicherungsleistungen seien rund 500 Millionen Euro bereitgestellt worden. Der kanarische Regionalregierungschef Ángel Víctor Torres rief die EU auf, mehr als die angekündigten 24,5 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen zur Verfügung zu stellen.
Die Menschen vor Ort erzählen von großer Hilfsbereitschaft. «Eine ältere Deutsche, die schon länger auf der Insel lebt, hat eines ihre beiden Häuser einer jungen Familie mit Kindern, die alles verloren hatten, geschenkt», erzählt Heinsch. «Sie könne ja sowieso nur in einem Haus wohnen und so habe sie Nachbarn, die etwas auf sie aufpassen könnten», habe sie gesagt. Andere hätten jedoch ihre Mieten einfach mal verdoppelt, weil so viel Wohnraum zerstört wurde und jetzt knapper ist.
Wer ein Haus hatte, das zerstört wurde, hat von der Versicherung sehr schnell den Wert ersetzt bekommen. «Man konnte sogar noch während des Vulkanausbruchs einen Vertrag abschließen, das Haus musste nur mindestens sieben Tage nach Vertragsabschluss überstehen, dann gab es sofort Geld», erzählt die Rechtsanwältin und Politikerin Floricela Rodríguez. Staatliche Beihilfen für unversicherten Hausstand von Mietern oder zur Anmietung von teurem Ersatzwohnraum waren ungleich schwieriger zu bekommen. «Wer reich war, ist jetzt reicher, wer arm war, ist jetzt ärmer», kritisiert Heinsch.
Autos rumpeln im Schritttempo über die staubige neue Piste, anhalten verboten, der Boden ist noch zu heiß, an einigen Stellen treten auch noch giftige Gase aus. «Das hier in Todoque war meine Gegend, hier kannte ich jede Ecke», sagt Heinsch ungläubig und versucht, sich in der zerklüfteten Vulkanlandschaft zu orientieren. Der «Dämon», wie die Menschen den nach erst rund drei Monaten kurz vor Weihnachten erloschenen Vulkan nennen, ist in einigen Kilometern Entfernung oberhalb in der Cumbre Vieja als schwarzes Loch mit schwefelgelbem Rand zu erkennen.
Der kleine Ort Las Manchas unterhalb des Vulkans ist dank der Behelfsstraße über das Lavafeld nun wieder etwas besser zu erreichen. Der Vulkan hat einen Teil des Ortes, ausgerechnet den, der Paradies hieß, komplett zerstört. Der Rest hatte Glück im Unglück und blieb verschont, aber bedeckt mit Massen von Vulkanasche, die immer wieder von den Dächern geschaufelt werden mussten. Die Sporthalle ist dennoch eingestürzt.
Von den rund 1500 Bewohnern, die monatelang evakuiert waren, sei erst etwa die Hälfte zurückgekehrt, erzählt Jenni Sánchez, Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins von Las Manchas. Das liegt auch daran, dass die Behelfspiste zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr geschlossen ist und niemand mit einem frühen Arbeitsbeginn in Las Manchas leben kann.
Auch die medizinische Versorgung sei schlecht. Nachts gebe es keinen Krankenwagendienst, was gerade ältere Bewohner von einer Rückkehr abhalte. Zudem ist auch die Schulsituation schwierig. Von den drei Schulen am Ort sei bisher nur eine wieder eröffnet worden, erzählt Sánchez, während sie an ihrer Limonade im «El Americano» nippt, eine rustikale Kneipe und Treffpunkt des Ortes.
Die 40-jährige Mutter von zwei Kindern kämpft dafür, dass ihr Ort und die Menschen nicht vergessen werden, sich ihr Leben wieder normalisiert. Aber das ist noch ein weiter Weg. «Das hier ist wie Dritte Welt. Wir existieren für die da oben einfach nicht», klagt die schmächtige Frau. Die Liste ihrer Klagen ist lang.
Bei vielen Häusern seien bisher weder die Anschlüsse für Wasser noch für Telefon repariert worden. Auch die Müllabfuhr funktioniere nicht, manchmal würden zwar Container aufgestellt, aber zu selten abgeholt, erzählt Sánchez. An den Straßen türmt sich Unrat, der Ratten und anderes Ungeziefer anlockt. Dazu kommen Reste asbesthaltiger Dachwellplatten, die einfach am Wegesrand abgekippt herumliegen.
Den Mund aufzumachen und öffentlich über die Behörden zu klagen, kann auch mal ungemütlich werden. Das hat auch die Rechtsanwältin Rodríguez erfahren. «Hier auf der Insel kennt jeder jeden, und wenn man jemandem mit Einfluss auf die Füße tritt, kann das schnell unangenehme Konsequenzen haben, auch für Verwandte», sagt die Vorsitzende der linksgrünen Partei Más Canarias. Sie hat mit einer Klage bei der Anti-Korruptionsstaatsanwaltschaft in Madrid gegen die Inselregierung wegen des geplanten Baus einer Straße vor kurzem für Furore gesorgt. «Wir werden dich zerstören», habe man ihr anschließend zu verstehen gegeben, sagt Rodríguez. Wer das war, lässt sie lieber offen.
Heinsch hat sich von den vielen Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen. Die gelernte Masseurin hat inzwischen wieder eine Anstellung als Empfangsdame in einem Hotel gefunden. Und nach einer Odyssee durch verschiedene Behelfsunterkünfte renoviert sie in Eigenarbeit mit ihrer Lebenspartnerin ein altes Bauernhaus.