Es war wie im Indianerdorf, einfach ohne Tipis. Die Eingeborenen saßen auf dem Boden um einen Eintopf herum, die Kinder spielten Fangis und drei Expats – um beim Bild zu bleiben, die Cowboys – saßen maulfaul am Tisch.
Einer davon war ich.
Wir hatten spontan zur Party in unserem Garten geladen, Lin brillierte in ihrer Rolle als Gastgeberin und ich in meiner als Beisitzer ohne Portefeuille, also als Vorkoster.
Während die Eingeborenen naturgemäß leicht ins Gespräch fanden, waren die Cowboys eher zurückhaltend, bis Freund Alk ihre Zunge gelöst hatte. Nach dem dritten Bier war es dann soweit. Neben meinem Nachbarn war der Dritte im Bunde ein Schreinermeister a.D. aus einem Land, das hier aus Datenschutzgründen nicht genannt werden darf, aber es liegt zwischen Deutschland und Italien. Er war zum ersten Mal bei uns, seine Thai-Freundin saß unten im Garten.
„Ich war in Papua-Neuguinea, kein Mensch glaubt, dass es dort noch Kannibalen gibt,“ sagte er mit dem Blick auf uns gerichtet, um die Wirkung seiner Worte zu prüfen.
Seemannsgarn als Vorspeise
Aha, dachte ich, die Stunde des Seemannsgarns ist gekommen, doch der Mann fuhr ja gar nie zur See, aber egal. Der Themenwechsel war allerdings ein bisschen irritierend, weil wir unmittelbar vorher noch von den Haiattacken in Hua Hin gesprochen hatten. Den Quantensprung zum Kannibalismus musste ich erst noch verdauen.
Meinem Nachbar ging es genauso. Wir schauten den Mann ein bisschen ratlos an, was er als Einladung nahm, die Sache näher zu erörtern und auch zu bebildern.
Er griff in seine Jackentasche, zog sein iPhone hervor und zeigte ein Foto herum, auf welchem eine junge Dame aus Papua-Neuguinea in der Landestracht zu sehen war. Sie bestand aus einem Baströckchen, das um das Gesäß der exotischen Dame schlenkerte und Tattoos mit magischen Symbolen. Die Papuas hatten offensichtlich bei der Bekleidung gespart, dafür umso großzügiger in die Haarpracht investiert. Sie trug einen farbenprächtigen Federbusch, den ich so nur bei Stammeshäuptlingen im Rentenalter gesehen hatte. Die ganze Erscheinung war ein Bild für die Götter, so sie denn kein Schamgefühl haben. Das hatten wir auch nicht und schauten genau hin, um etwas für die Allgemeinbildung zu tun.
Wir waren also in die Betrachtung dieser Naturschönheit vertieft, als uns die Stimme des Schreinermeisters a.D. wieder in die Realität zurückholte.
„Das ist meine Freundin,“ sagte er mit unverhohlenem Stolz, „ich gehe sie nächste Woche besuchen...“
„In Papua-Neuguinea... bei den Kannibalen?“, wollte ich ihn eben fragen, aber er schien meine Gedanken erraten zu haben und sagte: „In ihrem Dorf gibt es noch Kannibalismus...kein Scheiss… ich kann es euch beweisen...“
Aliens in der Tiefkühltruhe?
Ich zog es vor, ihm vorerst kein Bier mehr nachzuschenken. Wenn wir um acht Uhr abends schon bei den Kannibalen angelangt sind, was für eine Steigerung bleibt dann noch bis Mitternacht? Hat er bis dahin ein paar Aliens in der Tiefkühltruhe gebunkert?
„Da!“, rief er nun triumphierend aus, als hätte er meine Zweifel erahnt und könne sie mit einem Foto zerstreuen. Die Aufnahme war nun wirklich makaber. Man sah eine Ansammlung von blutverschmierten Köpfen auf einem Waldboden liegen. Sie waren alle dunkelhäutig und hatten krauses Haar. Einige starrten mit halbgeschlossenen Augen direkt in die Kamera, einer hatte nur ein Auge geöffnet, es sah aus, als wolle er seinem Kannibalen zum Abschied noch zuzwinkern: „Hey Buddy, alles nur Spaß, wir sehen uns nachher beim Bier, ok?“ Die Köpfe faserten nach unten aus, was darauf schließen ließ, dass sie nicht mit chirurgischer Präzision abgetrennt worden waren, sondern eher mit brachialem Gerät, also mit Macheten.
Alles fake oder was? Who knows.
Die Beweisaufnahme hätte ich mir gerne erspart. Ich ging in die Küche unter dem Vorwand, Kaffee zu machen, schenkte mir aber erstmal ein sattes Glas Whisky ein, um Albträumen zuvorzukommen. Als ich wieder bei den Gästen war, hatte das Gespräch eine verträglichere Wendung genommen. Man sprach jetzt über Voodoo-Praktiken, denn der Nachbar lebte einige Zeit auf Haiti und erzählte von Geisterbeschwörungen und Puppen, die real lebenden Menschen nachempfunden waren und die man mit Nadeln durchbohrt hatte, um ihnen auf diese Weise „die Lebensenergie“ zu entziehen.
Vodoo zum Nachtisch
Irgendjemand musste in diesem Augenblick auch eine Puppe mit meinem Ebenbild traktieren, denn ich fühlte mich immer schlaffer werden und zog mich nach meiner Meinung diskret zurück. Meine Frau meinte nach Feierabend, ich hätte mich ziemlich kopflos davon gemacht.
Kopflos? Ist ja kein Wunder.
 Über den Autor
Über den Autor
Khun Resjek lebt mit seiner thailändischen Frau und Tochter in Hua Hin. Seine Kolumne „Thailand Mon Amour“ illustriert auf humorvolle Weise den Alltag im „Land des Lächelns“ aus der Sicht eines Farang und weist mit Augenzwinkern auf das Spannungsfeld der kulturellen Unterschiede und Ansichten hin, die sich im Familienalltag ergeben. Ein Clash der Kulturen der heiteren Art, witzig und prägnant auf den Punkt gebracht.




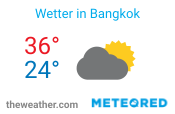


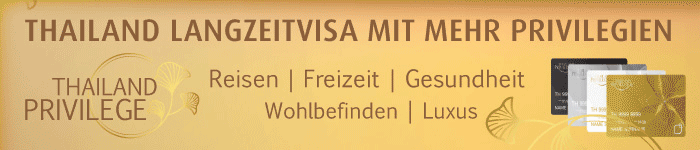

































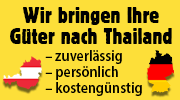









Leserkommentare
Vom 11. bis 21. April schließen wir über die Songkranfeiertage die Kommentarfunktion und wünschen allen Ihnen ein schönes Songkran-Festival.