BEIRA (dpa) - Der Tropensturm «Idai» hat in einem der ärmsten Länder der Welt eine Sintflut biblischen Ausmaßes ausgelöst. Tausende Menschen bangen um ihre Angehörigen. Helfer berichten von traumatischen Erlebnissen bei Rettungseinsätzen. Überlebende blicken bang in die ungewisse Zukunft.
Ein alter Fischkutter bringt eine Ladung verzweifelter Seelen an den Strand der Hafenstadt Beira in Mosambik: Dutzende Überlebende des Zyklons «Idai» stehen dicht beieinander auf dem rostigen Schiff und hoffen, an Land medizinische Versorgung, ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen zu finden. Die Passagiere sind gezeichnet vom Überlebenskampf der vergangenen Tage: Frauen mit schreienden Babys, Kinder in zerfetzten Klamotten und alte Menschen steigen zögerlich über eine winzige Leiter vom Bug des Schiffes auf den Strand. Die meisten haben wegen der vom Zyklon ausgelösten verheerenden Überschwemmungen Angehörige oder Freunde verloren.
«Ich hatte sieben Tage lang praktisch nichts zu essen oder zu trinken», sagt Silva Joa Quimba. «Ich stand bis zur Hüfte im Wasser.» Der 18-Jährige hatte Glück. Er schaffte es in der südlichen Stadt Buzi auf eines der Rettungsboote. Er spricht zurückhaltend und mit leiser Stimme. «Meine Mutter ist noch in Buzi. Ich weiß nicht, ob sie noch am Leben ist oder nicht.» Vom Strand bringen Hilfskräfte Quimba in eines der eilig errichteten Auffangzentren in Beira, wo gut 100.000 Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, zumindest notdürftig versorgt werden.
«Alle sagen, es wird so viele Tote geben», seufzt Quimba. Auch andere Bootspassagiere berichten, wie sie inmitten der Überschwemmungen rund eine Woche auf Hausdächern, in Baumkronen oder in höheren Gebäuden ausharrten und auf Hilfe warteten. Die Stadt Buzi am gleichnamigen Fluss liegt mitten in einem Gebiet, das Helfer als ein neu entstandenes «Binnenmeer» bezeichnet haben: Auf 125 Kilometern Länge steht infolge des schweren Tropensturms «Idai» im Zentrum Mosambiks meterhoch das Wasser. Als wäre die Lage noch nicht bedrohlich genug, tummeln sich dort Helfern zufolge inzwischen auch viele Krokodile.
Vor den Fluten lebten in dem Gebiet Hunderttausende Menschen. «Entweder sie konnten fliehen, oder es gibt dort eine sehr hohe Opferzahl», erklärt der Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms (WFP) in Beira, Pedro Matos. «Dort waren Dörfer und Ackerland», sagt er. Die Folgen der Überschwemmungen seien schlimmer als jene des Sturms. Die meisten Menschen in dem Gebiet waren demnach Kleinbauern - die Überlebenden haben daher meist nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihren Lebensunterhalt verloren. Der Katastrophenschutz spricht von rund 5.000 Quadratkilometern zerstörten Ackerlands, das entspricht etwa der doppelten Fläche des Saarlands.
Der Zyklon «Idai» der Stärke vier von fünf war am 15. März bei Beira auf Land getroffen. Der Sturm brachte Windböen von bis zu 190 Kilometern pro Stunde, Sturmfluten und schwere Überschwemmungen mit sich. Wegen der Überflutungen und ausgefallener Kommunikationsnetze war das Ausmaß der Katastrophe anfangs nicht ersichtlich. Doch inzwischen sprechen Helfer von einer der größten humanitären Notlagen weltweit.
Das WFP plant, rund 600.000 Menschen mit Nahrungsmittelhilfe zu versorgen. Mosambiks Regierung befürchtet mindestens 1.000 Tote. Rund 400.000 Menschen sollen zeitweise obdachlos geworden sein. Wegen der vielerorts ausgefallenen Trinkwasserversorgung droht inzwischen der Ausbruch schwerer Durchfallkrankheiten wie Typhus und Cholera.
Ein Rettungsboot hat auch Cecilia Manhime und ihre beiden kleinen Kinder nach Beira gebracht. «Es gibt so viel Leiden», sagt sie traurig. Als die Überschwemmungen begannen, konnte sie sich in ein Schulgebäude in Buzi retten. «Dann hörten wir, es würden noch schlimmere Fluten kommen», erinnert sie sich. «Als das Wasser die Schule erreichte, standen wir erst auf den Stühlen, dann stieg es weiter an und wir retteten uns aufs Dach.» Sie hatten tagelang nichts zu essen, sagt sie. «Ich hatte Angst, dass ich sterben würde.»
Manhime ist froh, dass sie ihre Kinder am Wochenende in Sicherheit bringen konnte. Doch auch in der Stadt Beira ist die Spur der Verwüstung überall zu sehen. Riesige Bäume liegen entwurzelt in den Straßen, Straßenlampen und Strommasten sind eingeknickt wie Kartenhäuser, vielerorts liegen die Reste vom Wind abgedeckter Dächer und Teile zerstörter Häuser. Die Menschen bahnen sich einen Weg durch Schutt und Unrat und bemühen sich, das Nötigste zu besorgen - Feuerholz, Essen und Trinkwasser. Viele müssen in Beira durch hüfttiefe Pfützen waten, um zu ihren Häusern zu kommen - oder dorthin, wo ihre Häuser einst standen.
Die Stadt mit rund 500.000 Einwohnern ist Helfern zufolge weitgehend zerstört. Es gibt keinen elektrischen Strom und kaum sauberes Trinkwasser, das Leichenhaus ist überfüllt. In den Notunterkünften der Stadt behandeln Helfer die Gestrandeten - manche haben Durchfall oder Fieber, viele andere haben Infektionen an den Füßen, die sich durch das lange Stehen im Flutwasser entzündet haben. Hilfsorganisationen warnen, dass sich die Preise für Grundnahrungsmittel in der überfüllten Stadt vervielfachen. Bis Sonntag - also zehn Tage nach dem Eintreffen des Sturms - war Beira wegen der Fluten nur aus der Luft erreichbar. Inzwischen ist eine Zufahrtsstraße wieder befahrbar, was den Hilfseinsatz erleichtert.
Der kleine Flughafen Beiras ist unterdessen zum Einsatzzentrum der Helfer geworden. Etwa ein Dutzend Helikopter schwirrt den ganzen Tag zwischen dem Flughafen und den überschwemmten Gebieten hin und her, um Menschen zu retten und Hilfe in Orte zu bringen, die immer noch von der Außenwelt abgeschnitten sind. Dutzende Mitarbeiter der Vereinten Nationen, Hilfsorganisationen und Journalisten campieren am Flughafen. Auch Militärangehörige aus Mosambik, Südafrika und Indien beteiligen sich am Hilfseinsatz. Das US-Militär will ebenfalls in Kürze Hilfe in die betroffene Provinz Sofala und nach Beira bringen.
Mosambik gehört einem UN-Index zufolge zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Die Regierung tut sich schon im Normalfall schwer, für die eigenen Bürger zu sorgen. Mit der Bewältigung der humanitären Katastrophe infolge des Zyklons ist Mosambik heillos überfordert. Die Regierung in der Hauptstadt Maputo - Luftlinie 700 Kilometer südlich von Beira - hat zunächst auch nur langsam auf den Sturm reagiert. Als «Idai» Beira verwüstete, weilte Präsident Filipe Nyusi im Ausland. Und dann brauchte die Regierung noch mehrere Tage, um die Alarmglocken schrillen zu lassen und internationale Hilfe zu erbitten.
Mosambik war auch in der Vergangenheit schon von schweren Zyklonen getroffen worden, die Hunderte Menschenleben kosteten und Hunderttausende zeitweise obdachlos machten. Die Wucht des Sturms «Idai», der sich seit Anfang März über dem Indischen Ozean in der sogenannten Straße von Mosambik gebildet hatte, übertraf jedoch die bisherigen Zyklone. Zudem traf «Idai» in Beira direkt auf eine Metropole. Jetzt kommt jeden Tag mehr Hilfe im Krisengebiet an, doch vielerorts fehlt es weiter am Allernötigsten. Helfer stellen sich auf einen langen und schwierigen Hilfseinsatz ein.
Der Zyklon hatte sich nach dem Eintreffen bei Beira abgeschwächt und war weiter nach Simbabwe gezogen. Dort, und auch im Nachbarland Malawi, kam es ebenfalls zu schweren Überschwemmungen. Nach UN-Angaben sind dort Hunderttausende Menschen betroffen. Im Osten Simbabwes etwa kamen nach Regierungsangaben mindestens 259 Menschen ums Leben, viele weitere gelten noch als vermisst. In Malawi - einem der 20 ärmsten Länder der Welt - verloren nach UN-Angaben wegen der Fluten mindestens 90.000 Menschen ihr Zuhause.
In Mosambik gehörte Travis Trower zu den ersten Helfern, die im Katastrophengebiet eintrafen. Der Südafrikaner seilte sich für die Hilfsorganisation SA Rescue immer wieder aus einem Hubschrauber ab und rettete so Dutzende Menschen aus den Überschwemmungsgebieten. «Wir sahen teilweise nur die Baumkronen aus dem Wasser ragen. Frauen haben uns aus den Bäumen ihre Babys zugeworfen», berichtet er.
Doch der 37-Jährige musste auch erleben, dass er vielen Menschen nicht mehr helfen konnte. Bei der ersten Rettungsmission etwa sei das Wasser zu schnell angestiegen, sodass der Einsatz nach der Bergung von 22 Menschen habe abgebrochen werden müssen, sagt er. Die anderen verzweifelt um Hilfe Bittenden mussten zurückgelassen werden. «Wir flogen am nächsten Morgen wieder hin, aber sie waren fortgespült worden.»
Juda Jonas Sithole aus der Stadt Buzi gehört zu jenen, die von einem Hubschrauber gerettet wurden. «Es war nicht einfach... Jemand kam an einem Seil herunter, um mich zu holen», erinnert sich der 34-Jährige. «In Buzi gibt es nur noch Wasser, alle Häuser sind zerstört. Ich war mir sicher, dass ich sterben würde.» Sithole hatte tagelang auf dem Dach seines Hauses ausgeharrt, bis er schließlich Glück hatte - doch er weiß nicht, ob seine Kinder noch leben. «Es gibt keine Kommunikation. Ich weiß nicht, wo meine Familie ist.»




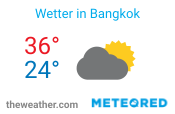





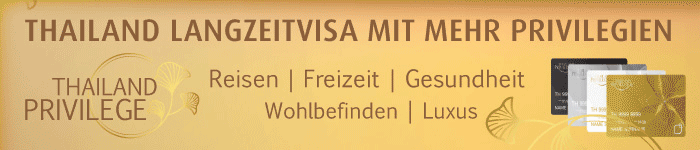























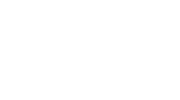

















Leserkommentare
Vom 11. bis 21. April schließen wir über die Songkranfeiertage die Kommentarfunktion und wünschen allen Ihnen ein schönes Songkran-Festival.