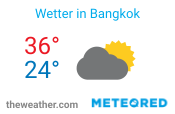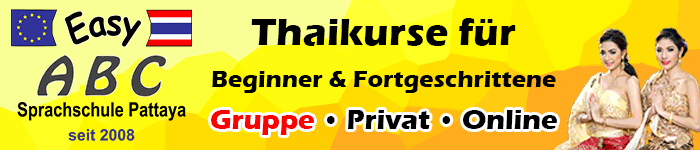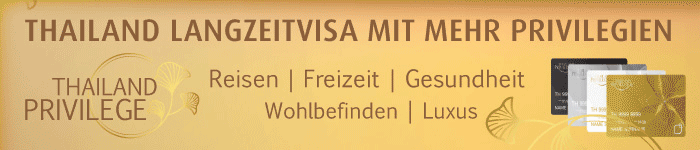MEXIKO-STADT (dpa) - Die Krise Venezuelas bekommen auch die Karibik und Mittelamerika zu spüren. Dort sind Länder vom günstigen Öl aus Caracas abhängig. Kuba und Nicaragua stehen ideologisch fest an Maduros Seite. Was würde sein Fall für die Verbündeten bedeuten?
Öl, Geld, ideologischer Rückenwind - der «große Bruder» Venezuela hat die verbündeten sozialistisch geprägten Staaten in Lateinamerika jahrzehntelang protegiert. Der Machtkampf zwischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó bedeutet nun auch für Nicaragua und Kuba Ärger. Während die Kubaner um ihre günstigen Öllieferungen bangen müssen, ist das politische Schicksal der autoritären Regierung in Nicaragua eng mit dem von Maduro verbunden. Könnten freie Wahlen in Venezuela auch für Bewegung in der politischen Krise Nicaraguas sorgen?
«Nicaragua segelt im Windschatten», sagt Hans-Georg Janze, Direktor der Heinrich-Böll-Stiftung in Mittelamerika. «Venezuela ist der große Bruder, das Schwergewicht.» Die Vorgänge dort werden auch auf Nicaragua abfärben. Lasse sich Maduro auf einen Friedensdialog ein, stünden auch die Chancen besser, dass Nicaraguas Präsident Daniel Ortega an den Verhandlungstisch mit der zivilen Opposition zurückkehre. Nicaragua werde sonst in Mittelamerika immer weiter isoliert, so Janze. Und vor allem: Dem Sandinisten geht das Geld aus.
Während im Jahr 2013 noch Öl im Wert von rund 559 Millionen US-Dollar von Venezuelas staatlichem Öl-Konzern PDVSA an die nicaraguanische Tochterfirma Albanisa flossen, schrumpfte die Menge 2017 auf einen Wert von nur noch 31 Millionen US-Dollar. Dies geht aus einem Bericht der Zentralbank Nicaraguas über die Kooperation mit Venezuela hervor.
Bei den Zahlungen handele es sich offiziell um Leihgaben, die zeitversetzt zurückgezahlt werden sollten, erklärt der Ex-Botschafter Nicaraguas in den USA und Kanada, Arturo Cruz, in einem Bericht für die US-Denkfabrik Wilson Center. Die Ortega-Regierung habe jedoch - im Einvernehmen mit Caracas - nie beabsichtigt, das auch zu tun. «Als konkretes Ergebnis wurden Daniel Ortega also eine bedeutende Menge an venezolanischen Geldern gegeben, die er im Grunde verwenden kann, wie er möchte.» Damit habe Ortega zwar das Wirtschaftswachstum des Landes gefördert, die Demokratie aber immer weiter ausgehöhlt, betont Cruz.
Mit Venezuelas sinkenden «Leihgaben» kam Ortega in Schwierigkeiten, geplante Sozialreformen im April 2018 lösten Proteste der Bevölkerung und damit eine politische Krise aus, die andauert. Der Präsident zog die Reform zwar zurück, die Demonstranten forderten aber seinen Rücktritt. Die Polizei und regierungsnahe Schlägertrupps griffen Protestierer an. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen kamen in dem Konflikt mehr als 500 Menschen um. Hunderte wurden inhaftiert.
Das Schicksal des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel hängt zwar nicht so sehr von dem Maduros ab wie das von Ortega, die seit Jahren anhaltende politische Krise in Venezuela trifft aber auch den sozialistischen Inselstaat. Zur Hochzeit bekam Kuba pro Tag rund 100.000 Barrel Öl aus Venezuela. Im Gegenzug stellte der Karibikstaat Mediziner für das südamerikanische Land bereit. Die Ölmenge hat sich seit mehreren Jahren jedoch halbiert. Kuba musste sich Alternativen suchen und wandte sich an Russland und Algerien.
Dass die Bande zwischen Venezuela und Kuba weiter eng sind, zeigte Caracas in der vergangenen Woche auch mit einer Hilfslieferung an den Inselstaat. Ein Schiff mit Tonnen an Baumaterial und Fahrzeugen erreichte den Hafen von Havanna. Die Lieferung war zur Unterstützung des Wiederaufbaus von Gebäuden gedacht, die Ende Januar bei einem schweren Tornado beschädigt wurden - zugleich verweigerte Maduro Hilfslieferungen an die Bevölkerung seines Landes. US-Präsident Donald Trump nannte Maduro jüngst eine «kubanische Marionette».
Im Falle eines kompletten Machtverlusts Maduros erwarten einige Experten einen Dominoeffekt bis nach Havanna. Weniger Unterstützung aus Caracas könnte die ambitionierten wirtschaftlichen Projekte von Díaz-Canel gefährden. Außerdem würde er seinen größten politischen Verbündeten verlieren, der in Lateinamerika ein Gegengewicht zu den USA hält. Mit dem Fall Maduros würde für Havanna «eine neue Welle politisch-diplomatischer und wirtschaftlicher Isolation vollzogen, die die Trump-Regierung fördert», schreibt der Analyst Domingo Amuchástegui von der unabhängigen Denkfabrik CubaPosible.
Unerwarteter Widerstand gegen Guaidó kam von einem Zusammenschluss kleinerer Karibikländer. Die Karibische Gemeinschaft Caricom besteht aus 14 Staaten, darunter Barbados, Jamaika und Guyana. Die Caricom-Unterstützung für die sozialistische Regierung Venezuelas geht zurück auf das Jahr 2005, als der damalige Präsident Hugo Chávez das Abkommen PetroCaribe ins Leben rief. Die Karibikstaaten bekommen dadurch Öl zum Vorzugspreis. 60 Prozent des Preises müssen dabei binnen 30 bis 90 Tagen gezahlt werden. Der Rest kann bis zu 25 Jahre danach abgestottert werden. Über den PetroCaribe-Fonds erhielt etwa der arme Karibikstaat Haiti Hilfsgelder, um 2010 nach einem verheerenden Erdbeben das Land wieder aufzubauen. Dass ausgerechnet Haiti sich gegen Maduro stellte, überraschte in der Region.
Die am nächsten zu Venezuela gelegenen Karibikinseln, die niederländischen Antillen, bekommen die Krise auf ganz andere Art zu spüren. Rund 15.000 Menschen flüchteten bereits aus Venezuela auf die etwa 80 Kilometer entfernte Insel Curaçao, schätzen Menschenrechtler. Die Insel mit nur rund 160 000 Einwohnern kann das nicht verkraften. Armut und Arbeitslosigkeit nähmen zu, melden die Behörden. Viele Flüchtlinge würden aus Angst vor Abschiebung oder Internierung in der Illegalität verschwinden. «Venezuelaner werden hier nicht geschützt, sondern abgeschoben oder in Lager interniert, als ob sie Verbrecher wären», sagte die Menschenrechtsorganisation «Human Rights Caribbean» der niederländischen Tageszeitung NRC Handelsblad.
Auf der Insel Curaçao soll ein Knotenpunkt für ausländische humanitäre Hilfe für Venezuela eingerichtet werden. Die Regierung in Caracas ließ am Dienstag den Luft- und Seeweg zwischen Venezuela und den Inseln Curaçao, Aruba und Bonaire schließen. Curaçaos Premier Eugene Rhuggenaath sagte dem niederländischen TV-Magazin Nieuwsuur bereits in der vergangenen Woche, er fürchte wegen der Stationierung von Hilfslieferungen Repressalien des Maduro-Regimes. «Wir sind uns bewusst, dass das Konsequenzen haben kann für Curaçao.»