ANTANANARIVO: Zehntausende stehen in Madagaskar kurz vor dem Hungertod. Seit vier Jahren herrscht Dürre. Es gibt kein sauberes Trinkwasser, nichts zu Essen. Und Regen ist nicht in Sicht.
Hunderttausende stehen in Madagaskar am Rande der Verzweiflung. Der Süden des tropischen Inselstaats, der nahe der Ostküste Afrikas im Indischen Ozean liegt, erlebt die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Es gibt kein sauberes Trinkwasser und kaum noch Nahrungsmittel. Seit Monaten leben die Menschen von Kakteenfrüchten, mit Tamarindensaft gemischtem Lehm, Heuschrecken und Blättern. Hilfsorganisationen sprechen von «katastrophalen Umständen».
Seit vier Jahren hat es in der Region gar nicht oder kaum geregnet. Auf den Feldern wächst schon lange nichts mehr. Übrig ist nur noch staubige Erde. Flüsse und Seen sind ausgetrocknet. Die meisten Nutztiere gestorben. Der nächste Regen wird nicht vor Mai erwartet - bis dahin sind es noch sieben Monate. Wenn er diesmal denn kommt.
Schon jetzt sind in Madagaskar nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) 1,14 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelnothilfe angewiesen. Rund 135.500 Kinder seien demnach akut unterernährt. Bis April werde die Zahl um eine halbe Million Kinder steigen. «Wir befinden uns am Beginn der mageren Saison. Wenn der Trend anhält, droht 28.000 Menschen der Hungertod», sagte WFP Madagaskar-Sprecherin Alice Rahmoun.
Die Hilflosigkeit steht den Einwohnern ins Gesicht geschrieben. Einige hätten versucht, sich aus Verzweiflung umzubringen, erzählt der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Madagaskar, Jean Francois Lepetit. Besonders dramatisch sei die Situation für Kinder. «Sie sehen so schlimm aus. Es tut weh, allein darüber zu sprechen. Sie sind unfassbar dünn», so Lepetit.
Wer ums tägliche Überleben kämpft, kann es sich nicht leisten, an die Zukunft zu denken. Bauernfamilien haben begonnen ihre Samen zu essen, die sie eigentlich anpflanzen wollten. Daraus entstehe ein gefährlicher Teufelskreis, warnen Hilfsorganisationen. Ohne Saatgut können die Landwirte in der nächsten Pflanzsaison ab März nichts anbauen. Damit wäre eine weitere Hungernot 2022 schon programmiert.
Doch soweit kann Mosa Tovontsoa, ein im südlichen Dorf Mitsangana lebender Bauer und Hirte, gar nicht denken. «Es ist besser, das Wenige zu essen, was man hat, als zu sterben», sagt der 46-jährige Vater von acht Kindern. So schlimm wie dieses Jahr sei die Not noch nie gewesen. «Vorher haben wir Dürren erlebt, aber nur für ein oder zwei Monate. Dann kam der Regen zurück und wir konnten erneut anbauen», erinnert er sich.
Fast schlimmer als der nagende Hunger sei der Wassermangel, erzählt Tovontsoa. «Im Fluss Mandrare gibt es keinen Tropfen Wasser mehr. Wir müssen tief im Flussbett graben, um an Wasser zu kommen», meint er. Sauberes Trinkwasser gäbe es in seinem Dorf schon lange nicht mehr; nicht mal Wasser zum Waschen. «Wir tragen seit Monaten die gleichen dreckigen Kleider», so Tovontsoa.
Nicht nur Madagaskar ist von einer ungewöhnlich starken Dürre betroffen. In vielen andren Teilen der Welt hungern in diesem Jahr mehr Menschen als sonst. In 43 Ländern sind nach Angaben der Vereinten Nationen 41 Millionen Menschen aktuell von Hungersnöten bedroht - ein drastischer Anstieg gegenüber 27 Millionen vor zwei Jahren. Am stärksten gefährdet sind 584.000 Menschen in Äthiopien, Madagaskar, dem Südsudan und Jemen, so die UN. Auch in Burkina Faso, Tschad und Nigeria ist der Hunger groß.
Dafür ist nach Angaben von Hilfsorganisationen eine unglückliche Kombination mehrerer Faktoren verantwortlich: langwierige bewaffnete Konflikte, Klimawandel, Sandstürme, Überschwemmungen, die Corona-Pandemie und Konjunktureinbrüche. Dazu kommen strukturelle Probleme wie weitreichende Armut, hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Regierungsführung, schwache Bildungssysteme und Abholzung.
Im Süden Madagaskars, wo die Hungersnot besonders akut ist, haben viele Menschen bereits ihr Hab und Gut verkauft, um die wenigen Nahrungsmittel, die es auf den Märkten noch gibt, zu kaufen. Doch die Preise sind in die Höhe geschossen, die meisten Waren unerschwinglich. Hilfsorganisationen schätzen, dass die diesjährige Nahrungsmittelproduktion um bis zu 70 Prozent unter dem bereits niedrigen Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt.
«Wir haben alles verkauft, was wir hatten, um essen zu können», sagt die 17-Jährige Enova, eine Bauerstochter aus der Ortschaft Amboasary-Atsimo. Ab und zu gebe es eine Süßkartoffel, doch meistens esse ihre Familie nur einmal am Tag bittere Kakteenfrüchte. Die medizinische Hilfsorganisation Ärzte Ohne Grenzen (MSF) berichtet von Massen an «völlig mittellosen Menschen». «Manche mussten ihre Kochutensilien verkaufen und haben nicht einmal Behälter, um Wasser zu holen», so MSF Madagaskar-Einsatzkoordinatorin Julie Reversé.





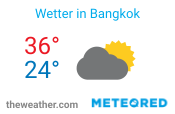





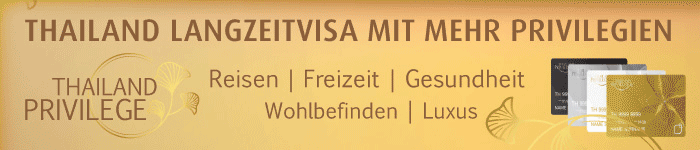
































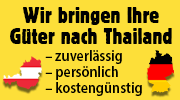














Leserkommentare
Vom 11. bis 21. April schließen wir über die Songkranfeiertage die Kommentarfunktion und wünschen allen Ihnen ein schönes Songkran-Festival.