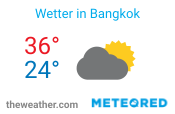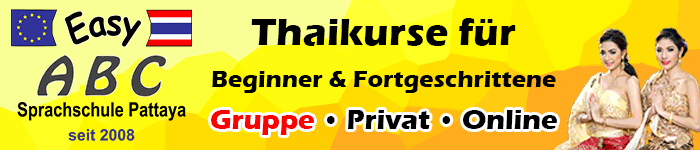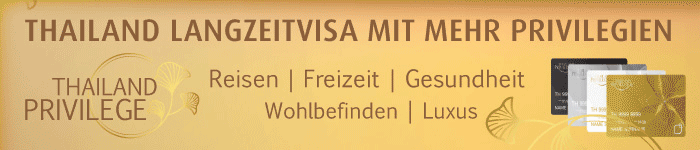BERLIN (dpa) - Man kennt Vargas Llosa als Liberalen. Zeit seines Lebens war der Peruaner ein politisch engagierter Autor. Jetzt erzählt er, wie er wurde, was er ist.
Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist ein streitbarer Literat. Wenn er nicht gerade an einem neuen Roman schreibt, verfasst er Kolumnen für die spanische Tageszeitung «El País» oder redet auf Kongressen. Oft schießt er dann scharf gegen lateinamerikanische Linkspopulisten oder katalanische Separatisten. Mit seinen entschieden liberalen Positionen hat er sich im Laufe der Jahrzehnte unter linken Intellektuellen viele Feinde gemacht. Einst war der 83-Jährige selber mal ein Linker, aber das ist lange her.
Nun hat Don Mario zur Feder gegriffen und sein politisches Credo aufgeschrieben. «Der Ruf der Horde» ist ein Plädoyer für den Liberalismus und zugleich - so der Untertitel - «eine intellektuelle Autobiografie». Vargas Llosa beschreibt darin, wie sich sein Denken entwickelt hat und welche großen Denker ihn dabei beeinflusst haben.
In sieben Essays stellt er sie vor: den schottischen Nationalökonomen Adam Smith (1723-1790), den spanischen Kulturphilosophen José Ortega y Gasset (1883-1955), den aus Österreich stammenden Volkswirtschaftler Friedrich August Hayek (1899-1992), dessen Landsmann, den Philosophen Karl Popper (1902-1994), den französischen Philosophen Raymond Aron (1905-1983), den russisch-britischen Philosophen Isaiah Berlin (1909-1997) und den französischen Schriftsteller Jean-François Revel (1924-2006).
Der Titel von Vargas Llosas Buch geht auf Popper zurück, dessen 1945 erschienenes Hauptwerk «Die offene Gesellschaft und ihre Feinde» das westliche Denken der Nachkriegszeit wesentlich beeinflusst hat. Die «Horde» steht bei Popper für die primitive Stammesgesellschaft, in der das freie Individuum noch nicht vorkam - totalitäre Ideologien wie Faschismus oder Kommunismus bedeuten einen Rückschritt dorthin. Für Popper gibt es keine absoluten Wahrheiten, eine Aussage ist nur so lange wahr, wie sie nicht falsifiziert worden ist. Und der Lauf der Geschichte ist nicht vorherbestimmt, anders als es die von Popper angeprangerten «Feinde» - Platon, Hegel, Marx - weismachen wollten.
Dem Marxismus war der 1936 geborene Vargas Llosa als Student durchaus zugetan. Wie die meisten seines Alters begeisterte er sich für die kubanische Revolution, als Fidel Castro 1959 den Diktator Fulgencio Batista stürzte und die USA herausforderte. Als aber Castro auf Kuba Arbeitslager einrichtete, Dissidenten verfolgte und den Schriftstellerkollegen Heberto Padilla eingesperrte, ging Vargas Llosas ein Licht auf. Eine Reise in die Sowjetunion - «eine traumatische Erfahrung» - machte den Bruch mit den linken Ideologien komplett.
«Meine Entscheidung für den Liberalismus war ein jahrelanger, vor allem intellektueller Prozess», schreibt Vargas Llosa. Anhand seiner sieben Meister macht der Peruaner, der auch die spanische Staatsangehörigkeit besitzt und heute in Madrid lebt, deutlich, was er unter Liberalismus versteht. Es ist ein breites Spektrum zwischen dem neoliberalen Ökonomen Hayek und dem Philosophen Berlin, der vor einer grenzenlosen Freiheit warnte («Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer»).
Der Liberalismus bedeutet auch für Vargas Llosa mehr als die Existenz freier Märkte. Vom kirchentreuen Konservativen unterscheidet die liberalen Intellektuellen, dass sie meist Agnostiker oder Atheisten sind. So zog Raymond Aron in «Opium für Intellektuelle» Parallelen zwischen Christentum und Marxismus und qualifizierte letzteren als «säkularisierte Religion».
Dass Vargas Llosa in seinem Buch auch lobende Worte für die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher und US-Präsident Ronald Reagan findet, mag all jene bestätigen, die in dem Nobelpreisträger einen «Rechten» sehen. Vargas Llosa versichert aber, dass er mit Reagan und Thatcher in wirtschaftspolitischen, nicht aber in gesellschaftlichen und moralischen Fragen übereinstimmte. Dass er kein Konservativer ist, machte Vargas Llosa unter anderem deutlich, als er 2014 mit einem Plädoyer für die Homoehe die peruanische Bischofskonferenz gegen sich aufbrachte.
Vargas Llosa, letzter Überlebender des «Booms» der lateinamerikanischen Literatur der 60er Jahre, hat ein ums andere Mal versichert, dass er mit dem Schreiben nicht aufhören könne und der Tod ihn mit der Feder in der Hand erwischen möge. 2010 erhielt er den Nobelpreis, seine seither erschienenen Romane verblassen vor seinem Frühwerk. In «Der Ruf der Horde» liefert er sieben lesenswerte Porträts verstorbener Geistesgrößen mit einer durchaus kritischen Würdigung ihres Denkens. Es ist das Werk eines gelehrten Lateinamerikaners, der Europa bewundert und sich im europäischen Denken besser auskennt als viele seiner europäischen Leser.