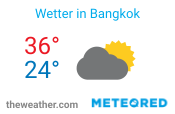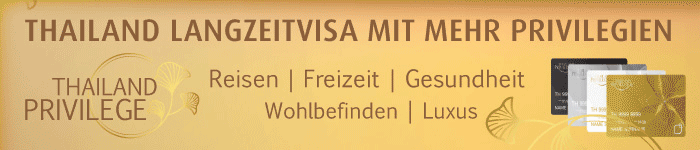FUKUSHIMA: Vor zehn Jahren verursachten ein Erdbeben und ein Tsunami einen Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima. Heute versucht der Staat, den Wiederaufbau der Region zu betonen, die Lage in der Atomruine sei unter Kontrolle. Krise bewältigt? Kritiker sehen noch viele Probleme.
«Zehn Jahre sind vergangen, und ich lebe noch», erzählt Akiko Iwasaki am Telefon und hält inne. Damals, an jenem 11. März 2011, war sie nur knapp dem Tode entronnen, als ein Erdbeben der Stärke 9,0 ihr Gasthaus an einer Meeresbucht erzittern ließ und ein Tsunami «wie ein wilder Drache» auf die Küste der nordwestlichen Region Tohoku traf. Ganze Ortschaften, Schulen, Friedhöfe und riesige Agrarflächen versanken in den gigantischen Wassermassen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu einem Super-GAU, der in der Welt zum Sinnbild der «3/11» genannten Dreifachkatastrophe wurde.
Heute, zehn Jahre danach, betont die Regierung die Erfolge beim Wiederaufbau Tohokus und versichert, dass in der Atomruine alles «unter Kontrolle» sei. Zudem habe man in Japan, das seit jeher mit der tagtäglichen Gefahr durch Erdbeben konfrontiert ist, als Lehre aus der Katastrophe von «3/11» die weltweit schärfsten Standards für das Anfahren von Atommeilern eingeführt, so die Regierung.
Heute seien alle Lebensmittel aus Fukushima, die auf den Markt kommen, vollkommen sicher, erklärte der Gouverneur von Fukushima, Masao Uchibori am Vorabend des 10. Jahrestages der Katastrophe und verweist auf Japans strenge Sicherheitsstandards bei Lebensmitteln.
Diese Botschaften will Japans Regierung der Welt auch bei den Olympischen Spielen im Sommer vermitteln. Dass viele Menschen in den Katastrophengebieten Tohokus jedoch auch zehn Jahre danach unter den Folgen der traumatischen Erlebnisse von «3/11» leiden, gerät im Rest des asiatischen Inselreiches dabei zunehmend in Vergessenheit.
Auch sie habe lange nur ihr eigenes Schicksal gesehen, sagt Iwasaki. Mit Schulden hat sie ihr vom Tsunami beschädigtes Gasthaus wieder aufgebaut. Dass viele andere Opfer im benachbarten Fukushima anders als sie entwurzelt wurden, sei ihr lange nicht bewusst gewesen. «Wir müssen zusammenhalten und nach vorne schauen», macht sie sich Mut.
«Tohoku hat sich nie wirklich vollständig erholt», erklärt Politikprofessor Koichi Nakano von der Sophia University Tokio der Deutschen Presse-Agentur. Die Bevölkerung ganzer Städte wurde umgesiedelt, was zum Verfall von örtlichen Gemeinschaften und zu Vereinsamung führte. Zwar hat der Staat mit einem gigantischen Aufwand weite Gebiete dekontaminieren lassen und die meisten Evakuierungsanordnungen inzwischen aufgehoben. Dennoch geht die Abwanderung, die es schon vor der Katastrophe im Zuge der Überalterung gab, weiter. «Viele Menschen fühlen sich zurückgelassen», erklärt Nakano.
Und dass es auch in der Atomruine weiter gewaltige Probleme gibt, zeigte sich erst dieser Tage wieder, als in Folge eines erneut starken Erdbebens vor Fukushima die Kühlwasserstände in den drei zerstörten Reaktoren 1 bis 3 abfielen, was auf neue Schäden hindeutete. Zudem kam dabei ans Tageslicht, dass der Betreiberkonzern Tepco bereits seit einigen Monaten von zwei defekten Seismometern in einem der drei Reaktoren wusste - aber sie nicht reparieren ließ.
Derweil müssen weiterhin Zehntausende Bewohner Fukushimas in Behelfsunterkünften leben. Ärzte beklagen eine andauernd erhöhte Rate an Depressionen, Selbstmorden sowie Posttraumatischen Belastungsstörungen unter Menschen in den radioaktiv verstrahlten Gebieten. «Es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem Ausmaß der radioaktiven Belastung am jeweiligen Wohnort in der Präfektur Fukushima und dem psychosozialen Stress, dem die Bevölkerung ausgesetzt wurde», erklärt Angelika Claußen, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Europavorsitzende der Ärzteorganisation IPPNW.
Sie wirft der japanischen Atomindustrie und dem Staat zudem vor, unabhängige Forschung zu den Folgen des Super-GAUS zu unterdrücken. Bislang sei lediglich Schilddrüsenkrebs systematisch untersucht worden. Besonders betroffen in Fukushima seien Kinder, die im Jahr der Kernschmelzen noch im Mutterleib waren. Noch heute gibt es Mütter, die aus Sorge um ihre Kinder kein Leitungswasser trinken. Viele sind in Netzwerken organisiert. Tausende flohen aus Fukushima, wo die Landwirte weiter massiv darunter leiden, dass viele Menschen trotz aller Aufklärungsbemühungen einen Bogen um ihre Produkte machen.
Die Unsicherheiten und Ängste wegen der Gefahren der Strahlung zerstörten auch viele Ehen. Während vor allem Frauen und Mütter noch heute Angst haben und den Verlautbarungen des Staates und mancher Medien nicht trauen, treibt Männer vor allem die Sorge vor Arbeitslosigkeit um. Es gibt zudem Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung - ein Phänomen, das in Japans Gesellschaft immer wieder auftritt, wenn Menschen Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind. So auch jetzt wieder bei der andauernden Corona-Pandemie.
Doch all diese Probleme sind im Rest des Landes zunehmend in Vergessenheit geraten. Das betrifft auch die vielen anonymen Arbeiter, die zur Dekontaminierung angeheuert wurden - darunter auch Obdachlose. Kritiker sprechen von Ausbeutung, doch niemand mache sich Gedanken über diese Menschen, die wie Aussätzige behandelt würden.
«Je weniger die Medien über die Probleme der Lokalbevölkerung berichten, desto mehr verschwindet das aus dem Bewusstsein der Menschen», erklärt Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ) in Tokio. Zugleich aber habe die Katastrophe viele soziale Bewegungen aufkommen lassen. Dazu gehören all jene Freiwilligen, die sich noch heute vor allem um die seelische Betreuung der Menschen kümmern, die entwurzelt wurden.
Doch während die Katastrophe in Fukushima in Deutschland bewirkte, dass die Regierung den Atomausstieg beschloss, blieben in Japan grundlegende gesellschaftliche Veränderungen zum Erstaunen vieler Beobachter aus. Der kurz nach der Katastrophe an die Macht gekommene rechtskonservative Ministerpräsident Shinzo Abe habe in all den vergangenen Jahren ein politisches Klima in Japan geschaffen, «das einem potenziellen Ruck durch die Gesellschaft komplett entgegensteht», so die Japanologin Gabriele Vogt. Abe wollte Japan «zurückholen» zu alter Stärke, ganz dem Image entsprechend, das die Welt von Japan hat. Auch diesem Ziel dienen die Olympischen Spiele.
Abe gelang es laut Beobachtern, dass die Opposition zersplittert und schwach da steht, die staatstragenden Medien noch zurückhaltender als zuvor schon geworden sind, und gerade viele Jüngere eine grundlegend apolitische Haltung an den Tag legen. Von den Massendemonstrationen bald nach der Katastrophe ist heute nichts mehr zu sehen. Zwar will die konservative Regierung unter Abes Nachfolger Yoshihide Suga die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf Null reduzieren. Dennoch hält sie weiter an der Atomenergie fest. Auch die Kungelei zwischen Regierung und Atomindustrie - Kritiker sprechen vom «Atomdorf», zu dem viele auch Japans staatstragende Medien zählen - besteht weiter, wie der zum Zeitpunkt des Super-GAUs regierende Ex-Premier Naoto Kan betont.
Noch während seiner Amtszeit war Kan von einem Befürworter zu einem entschiedenen Gegner der Atomkraft geworden. Damit steht er nicht alleine da. In Umfragen befürwortet die Mehrheit der Japaner heute eine Abkehr von der Atomenergie, was auch beim lokalen Widerstand gegen das Wiederanfahren von Meilern zum Ausdruck kommt. Unter der Oberfläche «köchelt es - auf kleiner Flamme», sagt Expertin Holthus.