ST. PETERSBURG: Bei ihrer Flucht aus besetzten Gebieten landen viele Ukrainer ausgerechnet in dem Land, das sie angegriffen hat. Im russischen Petersburg hilft ihnen ein orthodoxer Priester bei der Weiterreise in den Westen. Er bringt sich dabei selbst in große Gefahr.
Vater Grigori ist kein typischer Priester im Russland dieser Tage. Während der russisch-orthodoxen Kirche Kremlnähe und Kriegstreiberei vorgeworfen werden, verurteilt Grigori Michnow-Wajtenko beides: die politische Führung Russlands im Allgemeinen und den Angriff auf das Nachbarland Ukraine im Speziellen. Und er hilft denen, die unter den seit mehr als fünf Monaten andauernden Kämpfen besonders leiden: ukrainischen Geflüchteten, die gegen ihren Willen in Russland gelandet sind.
Als Kremlchef Wladimir Putin Ende Februar den Einmarsch in die Ukraine befahl, sei ihm klar gewesen, dass in Russland lebende Ukrainer Probleme bekommen könnten, sagt Vater Grigori. Da habe er beschlossen zu helfen. Der 55-Jährige sitzt im Außenbereich eines Cafés in der Ostsee-Metropole St. Petersburg, es ist Sonntagmittag, er kommt gerade aus dem Gottesdienst. Seine langen, etwas ergrauten Haare hat er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, immer wieder schaut er skeptisch gen Himmel, es sieht nach Regen aus.
Grigori stellte nach Kriegsbeginn ein Team von Freiwilligen zusammen. Damals meldeten sich vor allem Ukrainer, die schon länger in Russland leben, erinnert sich der Geistliche. Viele von ihnen haben rechtliche Fragen; wie sie ihre Dokumente verlängert bekommen, zum Beispiel. Mitte März dann kontaktierten ihn die ersten Flüchtlinge.
Hunderttausende Geflüchtete landen in Russland
Das UN-Büro für Migration zählt Ende Juni gut 5,2 Millionen Ukrainer, die sich im Ausland aufhalten, und weitere 6,2 Millionen, die innerhalb ihres Landes vertrieben wurden. Viele wollen Richtung Westen - doch oft ist das nicht möglich. Immer wieder beklagt Kiew, dass eigene Hilfskonvois nicht in besetzte Gebiete durchgelassen würden und Zivilisten stattdessen nach Russland brächten - ausgerechnet in das Land, das sie angegriffen hat.
Mitte Juli nennt der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak 1,6 Millionen Ukrainer, die gegen ihren Willen nach Russland gebracht worden seien, darunter 260.000 Kinder. Kiew spricht von «Deportationen». Russland beziffert die Zahl der eingereisten Ukrainer mit 2,7 Millionen, sie sollen alle freiwillig gekommen sein. Immer wieder behauptet der Kreml, die Menschen im Nachbarland von angeblichen Faschisten zu «befreien».
Hilfe in St. Petersburg
Die Geflüchteten, die seit März bei Vater Grigori in Petersburg eintreffen, haben existenzielle Probleme: Ihre ukrainischen Bankkarten funktionieren in Russland nicht, ihre Landeswährung Hrywnja bekommen sie nicht in russische Rubel umgetauscht. Viele wurden im Krieg verwundet. Grigori will allen helfen. Sein Freiwilligenteam wächst immer weiter. Es werden Spenden gesammelt, Schlafplätze und Begleitungen zu Behördengängen und Arztbesuchen organisiert. Außerdem kaufen er und sein Team den Menschen, die Russland verlassen wollen, Tickets für die Reise nach Europa.
Kritik an Kreml und Kirche
Es fängt jetzt wirklich an zu regnen. Das treffe sich gut, sagt Vater Grigori, er müsse nun ohnehin los, einen seiner Söhne vom Busbahnhof abholen. Er hat insgesamt sieben Kinder, sechs Jungen und ein Mädchen. Die Älteren hätten manchmal Angst um ihn, erzählt er während der Fahrt zum Bahnhof. Denn der Priester hält auch mit seiner politischen Einstellung nicht hinter dem Berg.
«Faktisch existiert in Russland mittlerweile ein komplett totalitäres Regime», sagt Grigori. Der Geistliche spielt auf die staatlichen Repressionen an, die in Russland seit Kriegsbeginn massiv zugenommen haben. Wer etwa angebliche Falschnachrichten über Russlands Streitkräfte verbreitet, dem drohen viele Jahre Straflager.
Grigori ist auch enttäuscht von der russisch-orthodoxen Kirche und deren Vorsteher, Patriarch Kirill. «Anstatt der Staatsmacht zu sagen, was sie falsch macht, nicken sie einfach und sagen: «Ja, das ist alles richtig so, hurra, Ruhm den russischen Waffen»», kritisiert er. Bereits 2014 tritt er aus der russisch-orthodoxen Kirche aus und in die apostolisch-orthodoxe ein.
Flucht aus Mariupol
In einem St. Petersburger Hostel, das die Freiwilligen angemietet haben, sitzen zwei Frauen, denen Grigori hilft. Sie haben fast alles verloren. Die 42 Jahre alte Maria und ihre 16-jährige Tochter Katja kommen aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol. Beide heißen in Wirklichkeit anders, doch ihre echten Namen zu nennen, trauen sie sich nicht.
Maria und Katja sind seit knapp einer Woche in St. Petersburg. Gerade waren beide beim Frisör - ein Geschenk der Freiwilligen. Marias kurze Haare sind blondiert, Katjas schulterlange Frisur an den Spitzen nach außen geföhnt. Der Mutter sind die Grauen der vergangenen Monate anzumerken, sie wirkt in sich gekehrt, antwortet freundlich, aber einsilbig. Katja hingegen ist die Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. «Endlich wieder Zivilisation», sagt sie über St. Petersburg mit seinen vielen Cafés und Touristenattraktionen.
In der Zeit der schlimmsten Kämpfe in Mariupol trauen sich Mutter und Tochter wegen der vielen Scharfschützen fast gar nicht aus ihrer Wohnung. Ein Verwandter sei mitten auf der Straße erschossen worden, erzählt Maria. «Er wollte Insulin für seine Mutter besorgen.»
Dann, Mitte Mai, wird Mariupol von Russlands Truppen erobert. Nun sind zwar die Straßenkämpfe weitgehend vorbei - aber auch die Möglichkeit, in Richtung Westen zu fliehen. Maria, Katja und Katjas Opa steigen in einen russischen Evakuierungsbus, werden zuerst ins grenznahe Taganrog gebracht, dann nach Rostow am Don. Dort haben sie Glück: Freiwillige werden auf die Familie aufmerksam, kaufen ihr Zugtickets nach St. Petersburg und kontaktieren Grigoris Hostel.
Nun wollen Mutter und Tochter weiter nach Finnland, Maria hat dort eine Freundin. «Ohne die Hilfe der Freiwilligen hätten wir das alles nicht geschafft», sagt sie. Dabei schaut sie zu einer Frau mit kurzen Haaren, die auf dem Bett links von ihr sitzt: Swetlana Kwaschina.
Kritik könnte den Job kosten
Swetlana Kwaschina ist pensionierte Ingenieurin, sitzt für die Oppositionspartei Jabloko in einem St. Petersburger Stadtbezirksparlament und seit einigen Monaten koordiniert sie das Hostel. Ihr Mann Sergej Swetunkow ist Hochschulprofessor und unterstützt die Flüchtlingshilfe in seiner Freizeit. Sergej bezeichnet sich scherzhaft als Swetlanas «Gehilfen», weil sie den Laden schmeißt und er ihre Aufträge annimmt, für die Ukrainer einkaufen geht oder sie zu Behörden fährt.
Im Internet betreibt Sergej einen Blog, auf dem er über sein Ehrenamt berichtet. Dort schreibt er Sätze wie: «Seit dem 24. Februar dieses Jahres sind friedliche Einwohner der Ukraine gegen ihren Willen in Russland gelandet.» Er wisse, dass seine kritische Einstellung ihn den Job kosten könne, wenn er Pech habe, sagt Sergej.
Beide müssen los, rund sechs Kilometer entfernt wartet ein weiterer geflüchteter Mann auf sie, dem sie über Bekannte eine Wohnung organisiert haben. Swetlana steuert das Auto, Sergej sitzt auf der Rückbank. Er freue sich, dass deutschsprachige Zeitungsleser nun von ihm und seiner Frau erführen, sagt er. «Sie sollen wissen, dass es auch Russen wie uns gibt.»
Sascha flieht, als er die ersten Schüsse hört
Alexander Bereschnoi, genannt Sascha, kommt aus der Stadt Woltschansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw. Sascha hat es dank seinem Behindertenausweis aus dem Land geschafft, normalerweise dürfen Männer wegen des Kriegsrechts die Ukraine derzeit nicht verlassen. Der 38-Jährige floh gemeinsam mit seinem körperlich schwer beeinträchtigen Freund Dima. Beide haben in Woltschansk im selben Heim gelebt, nun pflegt Sascha Dima.
Saschas Heimatstadt Woltschansk wird direkt am ersten Kriegstag von den Russen eingenommen, doch in der Nähe gehen die Kämpfe weiter. Als er vom Gelände seines Heims aus die ersten Schüsse hört, beschließt er, mit Dima zu fliehen. «An dem Tag hat es geregnet, ich erinnere mich ganz genau.» Es sei mühsam gewesen, Dima im Rollstuhl bis ins Stadtzentrum zu schieben, sagt Sascha.
Das wenige Ersparte der beiden Männer geht für ein Taxi zur nahe gelegenen russischen Grenze drauf. Von dort werden sie nach Belgorod gebracht, dann gelangen auch sie mithilfe von Freiwilligen nach Petersburg. Ob er nun hier bleiben wolle? «Weißt du, ehrlich gesagt, das ist mir egal», antwortet Sascha. «Hauptsache, ich lasse Dima nicht allein.»
«Christus war auch ein Flüchtling»
Der Mann, der Sascha, Maria, Katja und vielen anderen Ukrainern geholfen hat, weiß, dass er sich mit seinem Handeln und seinen Äußerungen zur Zielscheibe der russischen Behörden machen könnte. «Doch für mich wäre es viel schlimmer zu schweigen und so zu tun, als ob nichts wäre», sagt Vater Grigori. Auf die Frage, was ihn antreibt, hat der Priester direkt eine Antwort parat: «Ich bin kategorisch nicht einverstanden mit den Handlungen der russischen Regierung», sagt er. «Und zweitens: Christus war auch ein Flüchtling.»




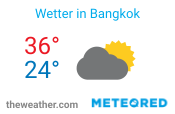






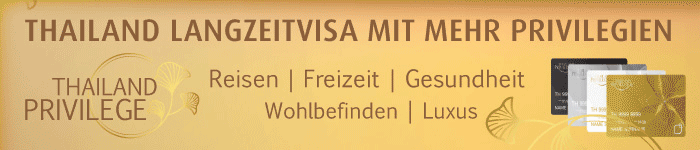









































Leserkommentare
Vom 11. bis 21. April schließen wir über die Songkranfeiertage die Kommentarfunktion und wünschen allen Ihnen ein schönes Songkran-Festival.