BERLIN (dpa) - Das Urteil von Steve Ballmer fiel vernichtend aus. Das offene Betriebssystem Linux sei «ein Krebsgeschwür», das «alles befällt, was es berührt», sagte der damalige Microsoft-Chef im Jahr 2001 in einem Zeitungsinterview. «Die Art und Weise, wie die Lizenz formuliert wurde, sorgt dafür, dass Sie Ihre gesamte Software als Open-Source-Software deklarieren müssen, sobald sie irgendeine Open-Source-Software verwenden.»
Linux war zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre alt und wurde von Ballmer längst als Bedrohung des Geschäftsmodells von Microsoft empfunden. Zuvor hatte bereits ein anderes Projekt mit akademischen Wurzeln den Softwareriesen aufgeschreckt. 1993 hatte Marc Andreessen an der University of Illinois den ersten Mosaic-Browser entwickelt und sich später mit Netscape daran gemacht, seine Software zur führenden Plattform im World Wide Web zu machen. Microsoft-Gründer Bill Gates nahm die Herausforderung an, ließ den Internet Explorer entwickeln und zettelte damit den «Browser-Krieg» an, in dem Netscape dann den Kürzeren zog.
Netscape ging in der Niederlage gegen Microsoft aber nicht spurlos unter, sondern hinterließ der Szene den Quelltext des Netscape Navigators, der wirtschaftlich scheinbar nicht mehr zu verwerten war. Aus diesem Code entstand dann später das äußerst erfolgreiche Mozilla-Projekt mit dem Firefox-Browser. Die Netscape-Führung ließ sich bei ihrer Entscheidung maßgeblich von dem Essay «Die Kathedrale und der Basar» leiten, das die US-Hacker-Legende Eric S. Raymond erstmals auf einem Linux-Kongress am 22. Mai 1997 in Würzburg öffentlich vorgetragen hatte.
In dem Text beschreibt Raymond die Vor- und Nachteile der im Open-Source-Bereich inzwischen weit verbreiteten Entwicklungsmethode des «Basars» gegenüber der traditionellen Methode, die er «Kathedrale» nennt. «Nach Auffassung der Erbauer der Kathedrale sind Programmierfehler und Entwicklungsprobleme knifflige, tief gehende und heimtückische Erscheinungen.» Es dauere Monate der Analyse, um Zuversicht in die Fehlerfreiheit des Codes zu bilden. «Daher die langen Intervalle zwischen den Freigaben und die langen Gesichter, wenn eine lang erwartete Release nicht fehlerfrei ist.» Auf dem Basar funktioniere das ganz anders. «Man geht davon aus, dass Fehler ein sehr triviales Phänomen sind, (...) wenn (der Code) tausend begeisterten Mit-Entwicklern ausgesetzt wird, die nach jeder neuen Release darauf herum trampeln.»
Vor 20 Jahren, am 3. Februar 1998, traf sich Open-Source-Vordenker Raymond mit anderen Aktivisten in Palo Alto im Herzen des Silicon Valley, um die Open Source Initiative (OSI) als gemeinnützige Organisation zu gründen. Seitdem wacht die OSI über die Grundprinzipien: Der Quellcode (Source Code) von Software darf kein Betriebsgeheimnis sein, sondern wird allen Interessierten offen bereitgestellt. Dann können andere den Code verbessern und ergänzen, müssen ihn aber wieder für die Community bereitstellen.
Diese Grundidee von freier Software schien über Jahre hinweg mit dem kommerziell betriebenen Software-Geschäft kaum vereinbar. Wie kann man mit «freier» Software das Geld verdienen, wenn diese in der Regel kostenlos verteilt wird? Und wie funktioniert ohne klassische Hierarchie-Strukturen eine Qualitätskontrolle? Die Aktivisten fanden darauf jedoch Antworten. So wurden beispielsweise Firmen wie SuSE und Red Hat auch kommerziell erfolgreich, weil sie kostenpflichtige Dienstleistungen rund um die offene Software bereitstellen. Google erwirtschaftet seine Werbe-Milliarden auch auf der technischen Basis von Open-Source-Projekten.
Die etablierten Softwarekonzerne taten sich aber schwer mit der Idee. Der damalige Microsoft-Boss Ballmer erhielt damals auch von anderen kommerziellen CEOs für seine Verdammung der offenen Software als «Krebs» viel Beifall. Die Open-Source-Kritiker konnten aber nicht verhindern, dass offene Projekte wie das Betriebssystem Linux, die Software-Entwicklungsplattform Git oder die inzwischen zu Oracle gehörende Datenbank MySQL quasi flächendeckend eingesetzt werden.
Ballmer-Nachfolger Satya Nadella hat auch längst seinen Frieden mit den Open-Source-Plattformen geschlossen. So sorgte er dafür, dass in der Microsoft-Cloud-Plattform Azure auch Linux - und nicht nur das hauseigene Betriebssystem Windows - einen sicheren Platz finden kann. Als Nadella auf der Konferenz «Build» 2016 eine Kooperation mit dem Linux-Anbieter Red Hat ankündigte, erschien hinter ihm eine Folie, auf der «Microsoft loves Linux» zu lesen war. Ein Kommentator auf Twitter fasste seine Verwunderung so zusammen: «(Das Linux-Tool) Bash auf Windows muss für Microsoft so sein wie für Star Trek, als zum ersten Mal Klingonen mitfliegen durften.» Und das Fachmagazin «PC World» meinte schockiert: «Die Hölle friert zu.»





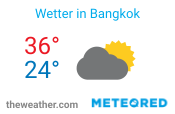


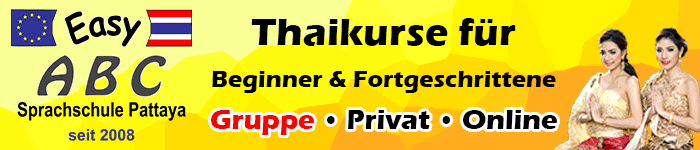



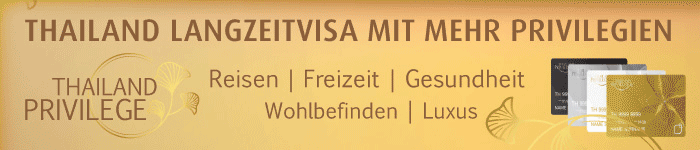



































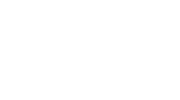










Leserkommentare
Vom 10. bis 21. April schließen wir über die Songkranfeiertage die Kommentarfunktion und wünschen allen Ihnen ein schönes Songkran-Festival.